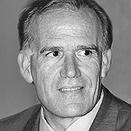Was taugt die Bush-Doktrin?
Verkennt sie die Ursachen des Terrors, ist sie nur irreführend oder gar ein voller Erfolg?
Als Reaktion auf die Attentate vom 11. September 2001 entwickelte die US-Regierung unter George W. Bush ein völlig neues Konzept der nationalen Sicherheit. Die „Bush-Doktrin“ betont zum einen die Notwendigkeit präventiver Militärschläge. Zum anderen sollen Gesellschaften, die als Brutstätten des radikalen Islamismus gelten, durch die aktive Förderung von Freiheit und Demokratie transformiert werden. Ob diese umfassende Neudefinition der Außenpolitik realisierbar ist und ob der Irak-Krieg in diesem Zusammenhang gerechtfertigt war, löste heftige Kontroversen aus. Ebenso heftig wird darüber debattiert, welchen Feinden die USA und der Westen gegenüberstehen, mit welchen spezifischen Maßnahmen ihnen die Bush-Regierung begegnen kann; wie leistungsfähig und durchhaltewillig die USA sind; wie die Beziehungen zu den traditionellen Verbündeten gestaltet werden sollen und wie es um die langfristigen Ziele und die moralische Glaubwürdigkeit der US-Außenpolitik steht. Das amerikanische Magazin Commentary bat anlässlich seines 60-jährigen Bestehens prominente Autoren, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. IP stellt vier Beiträge vor.
Zwei Prämissen, eine Katastrophe
Was ist der Terrorismus: Strategie oder totalitäre Ideologie?
von Paul Berman
Die Bush-Doktrin enthält zwei Prämissen, die nicht miteinander vereinbar sind und deshalb zu unglaublichen Fehlern in der amerikanischen Politik führten. Die erste Prämisse besagt, dass die USA und die Welt von Schurkenstaaten und gefährlichen nichtstaatlichen Akteuren bedroht werden, deren Motive im Grunde eigennützig sind. Unter amerikanischer Befehlsgewalt und mit Hilfe neuester Militärtechnologie gelte es, diese Feinde durch rasche militärische Aktionen zu unterwerfen. Die zweite Prämisse geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten und die Welt von einer ideologischen Bewegung bedroht werden, deren einziges Movens die willkürliche Ausübung von Gewalt ist und die den klassischen totalitären Bewegungen der Vergangenheit ähnelt. Da diese Bewegung auf Unterstützung in ihren Gesellschaften zählen könne, sei sie mit militärischen Mitteln allein nicht zu bezwingen. Vielmehr müsse eine ideologische Gegenbewegung diesen Totalitarismus im offenen Disput herausfordern und Erfolge durch die Errichtung von Institutionen absichern, die sich an liberalem und rationalistischem Gedankengut orientieren, kurz: in den Schlüsselregionen eine neue politische Kultur aufbauen. Um einer solchen Gegenbewegung zum Durchbruch zu verhelfen und sie sicher zu installieren, wäre militärische Gewalt als Anschub vielleicht notwendig. Letzten Endes aber müssten die Siege politischer und ideologischer Natur sein.
Die Verfechter der Bush-Doktrin haben meines Wissens die Prinzipien dieser zweiten Prämisse niemals im Detail dargelegt. Präsident Bush hielt zwar einige intelligente Reden über Totalitarismus und „Hassideologien“. Spricht er aber ohne Manuskript, bedient er sich eines saloppen Vokabulars, das eher einem Provinzpriester angemessen ist als einem Kampf der Ideen.
Wenn wir eine auf wahnsinnigen ideologischen Überzeugungen beruhende Massenbewegung besiegen wollen, dann müssen wir deren totalitäre Irrlehren in einem Kampf der Ideen besiegen. Die Bush-Regierung war nie fähig dazu, so etwas auf die Beine zu stellen – jedenfalls nicht so offen und ambi-tioniert, wie es in unserer gegenwärtigen Lage erforderlich wäre. (Mir ist natürlich bewusst, dass es in der Regierung Leute gibt, die ihr Bestes tun.) Stattdessen startete die Regierung völlig lächerliche PR-Kampagnen in der muslimischen Welt. Das verstärkt nur den Eindruck, bei der zweiten Prämisse der Bush-Doktrin handele es sich ebenfalls um einen PR-Trick, der nur dann aus dem Ärmel gezogen wird, wenn sich die Gelegenheit zu pathetischen Ansprachen bietet.
Wenn wir von einem neuen Totalitarismus ausgehen, dann sind die Implikationen auch für einen militärischen Laien wie mich leicht zu erkennen. Denn dann sollten militärische Aktionen vor allem der Unterstützung der politischen Transformation und dem Rückhalt der antitotalitären Bewegungen in der Bevölkerung dienen. Kampfmaßnahmen sollten demokratische und rationalistische Ziele unterstützen – und müssen daher so gut wie möglich mit liberalen Prinzipien vereinbar sein. Für die unweigerliche Frage, wie man militärische Aktionen mit einer großen Truppenstärke unternimmt, welche die Prinzipien der Demokratie respektieren und die Entstehung einer neuen politischen Kultur fördern, gibt es eine nahe liegende Lösung. Sie besteht darin, sich der schwerfälligen Mechanismen des internationalen Rechts und der multilateralen Institutionen zu bedienen. Die erste Prämisse der Bush-Doktrin erfordert eine Planung, die militärisch zweckmäßig, flexibel und der Weltöffentlichkeit gegenüber gleichgültig ist. Für die zweite ist es erforderlich, prinzipienfest und präzise vorzugehen und sich die Gewogenheit der Öffentlichkeit zu erhalten.
Präsident Bush hat versucht, diese beiden Prämissen miteinander zu verknüpfen. Das kann nicht funktionieren. Er beschrieb den Feind auf höchst widersprüchliche Weise und stürzte damit den größten Teil der Welt und uns Amerikaner in verhängnisvolle Verwirrung. Es schockiert mich, dass sich das Weiße Haus vier Jahre nach dem 11. September 2001 noch immer nicht über den grundsätzlichen Charakter unserer Feinde verständigen kann. Wir haben den Irak auf Grundlage der ersten Prämisse erobert und dann festgestellt, dass es richtiger gewesen wäre, auf der Grundlage der zweiten zu handeln. Das war katastrophal.
Die erste Bush-Regierung unterschätzte 1991 die Baath-Regierung und überließ Saddam den Sieg, indem sie ihm erlaubte, an der Macht zu bleiben. Damit betrog sie die irakischen Kurden und Schiiten, die massenweise abgeschlachtet wurden. Die Regierung von George W. Bush beging den gleichen Fehler. Zum zweiten Mal tragen die USA die Verantwortung dafür, dass Iraker – und damit unsere eigenen Verbündeten – massenhaft von unseren gemeinsamen Feinden getötet werden. Das gehört zum Schlimmsten, was die USA in der jüngeren Geschichte angerichtet haben.
Ginge es nach mir, müsste Bush, so wie es Abraham Lincoln im Bürgerkrieg tat, seine Spitzenberater feuern – bis ein neuer Ulysses Grant auftaucht, oder gleich mehrere. Ich sähe es gern, wenn der Präsident denjenigen europäischen Linken die Hand reichen würde (von den amerikanischen Demokraten ganz zu schweigen), die den Terrorismus ebenfalls für eine totalitäre Bedrohung halten. Ich gebe zu, das ist nur ein Traum. Diese Regierung ist viel zu sektiererisch, um so etwas zu tun. Ihre Indifferenz und Inkompetenz ersticken jede Bemühung im Keim, die Katastrophen der Vergangenheit zu korrigieren. Die gigantische Herausforderung, wie man den totalitären und faschistischen Bewegungen unserer Zeit Widerstand leisten kann, reduzierte sie auf die simple Frage amerikanischer Hegemonie. Wir sollten auf etwas anderes hinweisen: auf das Bedürfnis liberaler und demokratischer Gesellschaften, die Herrschaft von Prinzipien des menschlichen Anstands und des gegenseitigen Respekts fest zu etablieren. Wir sollten sämtliche Aspekte der Bush-Doktrin verwerfen, außer jenen, die man genauso gut als die Franklin-Roosevelt-Doktrin der Vier Freiheiten bezeichnen könnte. Die Vereinigten Staaten mit ihrem Wohlstand, ihrer Macht und ihren militärischen Kapazitäten sollten großzügige Mittel für die außenpolitischen Projekte der Zukunft bereitstellen, aber diese Projekte sollten aus dem Geist eines pragmatischen Internationalismus geboren werden und nicht aus dem Geist eines inkohärenten Nationalismus.
Eine irreführende Idee
Demokratie wird das Problem des Terrorismus nicht lösen
von Francis Fukuyama
Ich halte den zentralen Punkt der Bush-Doktrin – dass nämlich die USA den Nahen Osten transformieren müssten, um der terroristischen Bedrohung Herr zu werden – nicht nur für ein falsches Konzept. Das Problem wurde aufgrund einer äußerst ärmlich konzipierten Politik vor und nach dem Irak-Krieg auch noch verschärft.
Die Anschläge vom 11. September stellten zweifellos eine neue Art von Bedrohung dar. Die im Kalten Krieg üblichen Instrumente der Eindämmung und der Abschreckung vermögen gegen Selbstmordterroristen mit Massenvernichtungswaffen nichts auszurichten. Eine vollkommen gerechtfertigte Präventivmaßnahme war allerdings der Krieg in Afghanistan. Dort wurden Terrornetzwerke zerschlagen, die eindeutig eine Gefahr für uns darstellten.
Fatalerweise vermischte die Bush-Regierung das Thema Terror und Massenvernichtungswaffen mit dem Irak im Besonderen und der Weitergabe von Nukleartechnologie an Schurkenstaaten im Allgemeinen. Letzteres ist ernst zu nehmen. Aber es war niemals besonders wahrscheinlich, dass ein Schurkenstaat – der im Gegensatz zu staatenlosen Terroristen eindeutig zu identifizieren ist – den aufwändigen Prozess der Entwicklung von Kernwaffen auf sich nehmen würde, nur um diese an eine Terrororganisation weiterzugeben.
Die eigentliche Aufgabe besteht darin, die wahren Ursachen des Terrorismus zu erkennen und sich dann über die richtigen Mittel zu dessen Bekämpfung Gedanken zu machen. Der radikale Islamismus ist keineswegs die konsequenteste Ausformung traditioneller muslimischer Werte. Olivier Roy hat in seinem Buch „Globalized Islam“ überzeugend dargelegt, dass der Islamismus als modernes Phänomen gesehen werden muss, das durch die Entwurzelung des Islams vor allem in Westeuropa sowie durch die Kräfte der Globalisierung und Modernisierung hervorgebracht wird. In der traditionellen muslimischen Sozialstruktur wird die individuelle Identität durch die Gesellschaft vorgegeben, in die man hineingeboren wird; nur in einer nichtmuslimischen Umgebung kommt die Frage auf, wer man eigentlich ist. Die daraus resultierende tiefe Entfremdung macht unzureichend integrierte Muslime der zweiten und dritten Generation empfänglich für eine reine, allumfassende Ideologie wie die von Osama Bin Laden. Mohammed Atta und die anderen Organisatoren des 11. September, die Verschwörer von Madrid und London sowie Mohammed Bouyeri, der Mörder des niederländischen Filmemachers Theo van Gogh, fallen in diese Kategorie. Ein Mehr an Demokratie und Modernisierung könnte also unser Terrorismusproblem kurzfristig nicht lösen, sondern verschlimmern. Demokratie und Modernisierung sind Werte für sich und sollten um ihrer selbst willen im Nahen Osten gefördert werden. Ganz unabhängig von den Entwicklungen in der Region aber wird es im demokratischen Westeuropa auch weiterhin ernsthafte Probleme mit dem Terrorismus geben.
Vielleicht muss der Nahe Osten tatsächlich „in Ordnung gebracht“ werden. Aber wie kamen wir auf den Gedanken, wir seien dazu in der Lage? Seit Jahrzehnten reden die Neokonservativen über die unerwünschten Folgen übertriebenen sozialen Engagements und die Aussichtslosigkeit des Bemühens, die Ursachen sozialer Probleme zu beseitigen. Wenn das für die Bekämpfung von Kriminalität und Armut in amerikanischen Städten gilt, wie sollten wir dann zu den Ursachen von Entfremdung und Terrorismus in Regionen vordringen können, die wir kaum kennen und in denen unser politischer Einfluss sehr begrenzt ist?
Ein weiterer Vorbehalt gegen die Bush-Doktrin betrifft eine Eigenheit der Vereinigten Staaten. Wir waren im Laufe der Geschichte oft mit Nation Building beschäftigt: in den Südstaaten nach dem Bürgerkrieg, auf den Philippinen, in Japan, Deutschland, Südkorea und Südvietnam und schließlich im Gefolge der humanitären Interventionen nach dem Ende des Kalten Krieges in Somalia, Haiti und auf dem Balkan. Wirkliche Erfolge konnten wir nur in Japan, Deutschland und Südkorea verzeichnen, von wo die amerikanische Besatzungsmacht im Grunde nie wieder abzog. Die Amerikaner haben die Gewohnheit, sich enthusiastisch in derartige Projekte zu stürzen – und das Interesse daran zu verlieren, sobald sich die Lage verschlechtert. So war es beim Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg, in Nicaragua zwischen 1927 und 1932 oder in Südvietnam. Wir finden lokale Verbündete, versuchen, dort moderne Institutionen zu errichten und überlassen sie dann sich selbst. Ich befürchtete vor dem Beginn des Irak-Krieges, dass sich dieses Muster wiederholen würde. Bislang wurde ich nicht eines Besseren belehrt.
Wir müssen in Afghanistan und im Irak militärisch gewinnen und dem Druck widerstehen, die amerikanischen Truppen frühzeitig zu verringern. Aber wir müssen uns auch für den weiteren Verlauf des Krieges gegen den Terrorismus etwas einfallen lassen. Für eine klassische Aufstandsbekämpfung im globalen Rahmen ist es genauso wichtig, die Herzen und Köpfe zu gewinnen wie den harten Kern der Terroristen auszuschalten. Ich glaube fest an die Notwendigkeit einer weitblickenden Außenpolitik, die auf die innere Verfasstheit von Staaten und nicht nur auf ihr äußeres Verhalten Einfluss nimmt. Aber Soft Power, nicht Hard Power, ist das notwendige Mittel, um weltweit Demokratie und Entwicklung zu fördern.
Vier Jahre nach der Formulierung der Bush-Doktrin haben die USA im Irak einen neuen Zufluchtsort für Terroristen sowie ein Machtvakuum geschaffen, das die regionale Politik noch für geraume Zeit destabilisieren wird. Die Eliten sind möglicherweise an einer guten Beziehung zu Washington interessiert. In der Öffentlichkeit aber hat sich das Image Amerikas rasant verschlechtert. Ob uns das gerecht wird oder nicht – in jedem Fall ist das Symbol Amerikas nicht mehr die Freiheitsstatue, sondern der vermummte Gefangene von Abu Ghraib. Diesen Schaden wieder gut zu machen wird noch viele Jahre dauern.
Ein voller Erfolg
Die USA haben für einen überfälligen Umbruch gesorgt
von Victor Davis Hanson
Glaubt man Meinungsumfragen, dann stehen die meisten Amerikaner Bushs Außenpolitik mittlerweile kritisch gegenüber. Sie sind nicht bloß wegen der täglichen Selbstmordattentate im Irak verunsichert. Viele lehnen den Krieg mittlerweile auch wegen der andauernden öffentlichen Attacken auf die amerikanische Außenpolitik von Seiten der Linken und der extremen Rechten ab. Unter diesen finden sich nicht wenige, die ursprünglich einen Präventivschlag befürwortet haben. Jetzt behaupten sie, dass sie die Absetzung Saddam Husseins zwar begrüßten, aber entsetzt darüber sind, was danach folgte. Man habe einen Militäreinsatz befürwortet, von dem man dachte, er werde ebenso perfekt wie sauber ablaufen. Mit der schmuddeligen Realität des Wiederaufbaus will man nichts zu tun haben – als hätte es in Amerikas früheren Kriegen nie tragische Irrtümer und fehl geschlagene Aktionen gegeben.
Doch trotz der Medienhysterie und der unbestreitbaren Fehler bei der Im-plementierung zeigt die Bush-Doktrin Erfolge, die sich bald zu dauerhaften Fortschritten entwickeln könnten. Abgesehen von unserer Unfähigkeit, die Gefahren und Kosten des Krieges gegen den radikalen Islam klar zu benennen und unser gesamtes militärisches Potenzial darauf zu konzentrieren, abgesehen auch davon, dass unsere eigene Südgrenze gegenüber terroristischer Infiltration verwundbar bleibt, gab es in den vergangenen vier Jahren enorme Fortschritte.
Wir haben sowohl die Taliban als auch Saddam Hussein gestürzt. Dabei ließen 2000 amerikanische Soldaten ihr Leben. Das ist ein schwerer und beklagenswerter Verlust. Doch am ersten Kriegstag, dem 11. September 2001, wurden über 3000 amerikanische Zivilisten getötet. Der vorausschauenden Strategie, hart gegen Schurkenstaaten vorzugehen und beim Wiederaufbau zu helfen, ist es – in Verbindung mit erhöhter Wachsamkeit im eigenen Land – zu verdanken, dass die USA vor weiteren Anschlägen verschont blieben.
Im Irak selbst hat sich eine konstitutionelle Regierung auf einen mühseligen Weg nach vorne begeben, und eine Reihe von Wahlen trug zur Ratifizierung und/oder Verbesserung bei. Immer wieder rückt in den Diskussionen das unnachgiebige Verhalten der Sunniten in den Vordergrund. Doch diese Minderheit, die nicht über Öl verfügt, ist durch ihre ruchlose Unterstützung für Saddam und die Zarkawi-Terroristen in eine unhaltbare Position geraten. Ihre Kleriker haben die irakischen Sunniten dazu aufgerufen, bei der Abstimmung über die Verfassung mit Nein zu stimmen, obwohl sunnitische Extremisten wie Sarkawi alle mit dem Tod bedrohen, die überhaupt zur Wahl gehen.
Ohne Frage findet eine radikale Veränderung der politischen Kultur in dieser Region statt. Die Präsidentschaftswahlen in Ägypten wurden zwar boykottiert und manipuliert. Dennoch waren sie ein beispielloses Ereignis, und auf die Wahlmanipulation reagierten die Ägypter äußerst rasch mit Massendemonstrationen. Auch in anderen Ländern zeichnen sich unerhörte neue Entwicklungen ab. Libyen und Pakistan verzichteten auf die Weiterentwicklung ihres Atomwaffenprogramms; die Syrer zogen sich aus dem Libanon zurück und in der Golf-Region formieren sich Parlamente, die sich zu mehr als nur Marionetten der Regierung entwickeln. Sogar in Palästina haben der Tod Arafats, der Bau eines Sicherheitszauns, der israelische Rückzug aus Gaza und der Sturz Saddam Husseins die Position der zuvor marginalisierten Reformer im Westjordanland gestärkt. Stück für Stück geht die Aufgabe, Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen, an die Palästinenser über. Schließlich sind sie auch dafür zuständig.
Selbstverständlich entstehen im Nahen Osten jetzt keine Schweizer Kantone. Aber wir erleben die Anfangsbeben massiver tektonischer Verschiebungen, bei denen die Kontinentalplatten des islamischen Radikalismus und der säkularen Autokratie etwas Neuem und Demokratischerem Platz machen. Die USA sind der Hauptkatalysator dieses volatilen, gleichwohl lange überfälligen Umbruchs. Sie haben das Risiko fast völlig allein auf sich genommen – der Lohn ist eine stabilere Welt für alle.
Man macht gern viel Aufhebens über den weltweiten Antiamerikanismus und den Hass auf George W. Bush. Doch bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass dieser Furor hauptsächlich auf Westeuropa, den autokratischen Nahen Osten und unsere eigenen intellektuellen Eliten beschränkt ist. Unsere lautstärksten Kritiker in Europa, Chirac und Schröder, haben beträchtlich an Rückhalt verloren; Schröder sogar sein Amt. In Europa macht sich eine Opposition von Realisten bemerkbar, die sich um die Integration ihrer eigenen Minderheiten sorgt und für amerikanische Beharrlichkeit im Krieg gegen den radikalen Islam dankbar ist. Osteuropäer, Japaner, Australier und Inder standen den USA niemals näher als heute. Russland und China haben gegen unseren Krieg gegen den Terror wenig einzuwenden.
An der Heimatfront ist die vergleichsweise geringe überparteiliche Unterstützung zum Teil auf die von der Linken geprägte Medienkultur zurückzuführen, zum Teil auf die ebenso lautstarken wie missgünstigen Attacken einer ausgebrannten Demokratischen Partei, aber auch auf eine Unsicherheit über den Verlauf und die Zukunft der von der Bush-Doktrin in Gang gesetzten Entwicklungen. Die extreme Rechte wiederum sieht nur zu hohe Ausgaben, einen zu starken Staat und hinter den Kulissen zu viel Israel.
Was liegt vor uns? Säkulare Diktaturen und islamistische Regime sind ebenso inakzeptabel wie gefährlich. Wir sollten sie meiden, selbst wenn wir dafür die Empfänger amerikanischer Hilfsgelder und Militärhilfe – wie Mubarak, Muscharraf und die saudische Herrscherfamilie – zur Reform drängen müssen. Zu Hause wird unsere Fähigkeit, uns vor internationaler Erpressung zu schützen, sehr bald erodieren, wenn uns keine praktikable Lösung einfällt, wie man die Ölproduktion steigert und gleichzeitig Umweltschutz und alternative Energien fördert. Das Bedrohlichste wären aber Atomwaffen in den Händen des Irans oder eines der übrigen undemokratischen Länder im Nahen Osten. Dies könnte das meiste, wenn nicht sogar alles zerstören, was bisher erreicht wurde. Was wäre geschehen, wenn Amerika in den späten dreißiger Jahren von rumänischer oder deutscher Kohle abhängig gewesen wäre, oder wenn Hitler, Mussolini oder Franco kurz davor gestanden hätten, Atomwaffen zu bauen?
Unsere Bemühungen in Afghanistan und im Irak und unser Insistieren auf Reformen im Nahen Osten unterstütze ich weiterhin ohne jedes Zaudern. Und zwar nicht deshalb, weil die Bush-Doktrin einem bestimmten Programm folgt (ich war der Meinung, dass der Brief des Project for a New American Century vom 28. Januar 1998, der auf die Absetzung Saddam Husseins drängte, wenig durchdacht war), sondern vielmehr, weil in der Ära nach dem 11. September ein kraftvoller Idealismus den neuen amerikanischen Realismus und damit das einzige Gegengift gegen den islamischen Radikalismus und seinen terroristischen Anhang darstellt.
Unser gegenwärtiges Vorgehen ist nicht motiviert durch die Bestrebung, ein Empire aufzubauen oder ökonomische Vorteile zu gewinnen. Auch folgt es nicht unbekümmert irgendeiner Utopie. Es hat sich schlicht und einfach die Verbreitung der Demokratie zum Ziel gesetzt. Dafür werden wir unsere Präsenz in Deutschland und Südkorea verringern und unsere Truppen aus Saudi-Arabien zurückziehen. Das ist eindrucksvoll und bewundernswert. Wie nennen wir diese robuste neue Doktrin, die weder mit dem naiven Idealismus Wilsons noch mit der Realpolitik des Kalten Krieges etwas zu tun hat? Man könnte sie als aufgeklärten Jacksonianismus bezeichnen: als die Entschlossenheit, dann – und nur dann – die erforderlichen Militäreinsätze zu unternehmen und politische Reformen voranzutreiben, die unseren demokratischen Werten entsprechen, wenn die Aufrechterhaltung des Status quo die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedroht.
Kein müder Titan
Sondern Weltmacht mit fundamentalem Gespür für die Realitäten
von Robert J. Lieber
Mit der Bush-Doktrin wurde eine konsequente und visionäre Militärstrategie für die Vereinigten Staaten festgeschrieben. Logik und Absicht dieser Doktrin verdienen auch vier Jahre nach dem 11. September weiterhin Unterstützung, denn obwohl sie im In- und Ausland häufig falsch dargestellt wurde, liefert sie eine sachkundige Diagnose der Bedrohung und einen umfassenden Leitfaden dafür, wie dieser Bedrohung entgegenzutreten ist – mit Prävention, militärischer Überlegenheit, einem neuen Multilateralismus (soweit möglich) und der Verbreitung der Demokratie. Es war nicht zu vermeiden, dass die Ausführung dieser Politik mit – bisweilen gravierenden – Mängeln behaftet war. Doch insgesamt beruht die Strategie auf einem fundamentalen Gespür für die heutigen Realitäten, das den Kritikern der Regierung häufig fehlt.
Meine Einschätzung geht von drei Prämissen aus. Erstens sind wir mit einer präzedenzlosen Bedrohung konfrontiert: der Kombination von islamistischem Terrorismus und Massenvernichtungswaffen. Eindämmungs- und Abschreckungsdoktrinen, die im Kalten Krieg ihren Zweck erfüllten, helfen hier nicht weiter. Daraus folgt, dass wir bereit sein müssen, notfalls präemptiv und selbst präventiv Gewalt auszuüben. Zweitens erweisen sich die Vereinten Nationen fast immer als handlungsunfähig, wenn es um die wirklich ernsten und dringenden Probleme geht. Drittens werden, eben weil die USA die einzige Supermacht sind, andere zwangsläufig auf amerikanische Führung setzen. Die Vereinigten Staaten können und sollen sich um Zusammenarbeit mit anderen Staaten bemühen. Doch wenn wir nicht die Führung übernehmen, wird es wohl kaum jemand anders tun. Solange die Bedrohung durch Terrorismus und Massenvernichtungswaffen besteht, und solange Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit oder die Verhinderung von Völkermord von niemand anderem garantiert werden, braucht sich Amerika für Einmischungen und Interventionen nicht zu rechtfertigen.
Obwohl es nicht nur Fortschritte gab, hat die amerikanische Politik doch Wesentliches geleistet: Al-Qaida und andere Terrorgruppen profitieren nicht mehr von staatlicher Unterstützung und Zufluchtstätten in Afghanistan und im Irak; das tyrannische Regime Saddam Husseins und damit eine ernsthafte strategische und regionale Bedrohung wurde beseitigt; zumindest Teile des Al-Qaida-Netzwerks sind gespalten und zerstört; Bestrebungen einiger Islamisten, bestehende Regierungen zu stürzen und Kontrolle über alle Staaten des Nahen Ostens zu gewinnen, wurden vereitelt; Libyen verzichtete auf sein Massenvernichtungswaffen-Programm; das pakistanische Netzwerk von A.Q. Khan zur Beschaffung von Nuklearmaterial wurde aufgedeckt und unschädlich gemacht; es gibt erste Anzeichen für einen „arabischen Frühling“; und bis jetzt konnten die USA einen weiteren größeren Terroranschlag auf ihrem Territorium verhindern.
Selbstverständlich können wir diese Errungenschaften nicht isoliert betrachten, sondern müssen eine Reihe anderer Faktoren bedenken: die anhaltenden Kämpfe im Osten Afghanistans; die schmerzlichen und kostspieligen Aufstände im Irak, die zum Zentrum des radikalen Widerstands gegen die USA geworden sind; die Gefahr, die von einer nuklearen Bewaffnung Nordkoreas und des Irans ausgeht; das langfristige Risiko einer innenpolitisch instabilen Atommacht Pakistan; die anhaltende Bedrohung durch radikale Islamisten und schließlich das Wissen darum, dass der Weg zur politischen Liberalisierung und Demokratisierung lang und steinig ist. Darüber hinaus herrscht in weiten Teilen Europas und des Nahen Ostens ein antiamerikanisches Klima. Auch müssen wir uns fragen, ob weitere Terroranschläge gegen die Vereinigten Staaten vielleicht nur eine Frage der Zeit sind.
Wir haben es also nicht mit einer nur kurzfristig gültigen Agenda zu tun. Der globale Krieg gegen den islamistischen Terrorismus könnte sich als genauso langwierig herausstellen wie der Kalte Krieg, und er muss ebenso sehr mit politischen, wirtschaftlichen, ideologischen und geheimdienstlichen Mitteln ausgetragen werden wie mit konventionellen Militäreinsätzen.
Ebenso wie im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg ist natürlich eine gewisse politische Flexibilität nötig. Eine der größten Stärken der Vereinigten Staaten ist die Fähigkeit, rechtzeitige Kurswechsel vorzunehmen. Sicherlich ist es immer einfacher, auf Unzulänglichkeiten der Vergangenheit hinzuweisen, als vorzuschlagen, wie man es künftig besser machen könnte. Dennoch seien die Probleme benannt: Man war auf einen Irak nach Saddam nicht wirklich vorbereitet und hatte keine brauchbare Strategie für die unmittelbare Folgezeit des Krieges. Man schaffte es nicht, der Öffentlichkeit zu vermitteln, worum es geht (diese Unfähigkeit geht zurück bis in die Clinton-Regierung). Wie die Katrina-Katastrophe jüngst gezeigt hat, werden Schlüsselpositionen gern mit Leuten besetzt, die sich eher durch politische und persönliche Beziehungen als durch Kompetenz auszeichnen. Der Öffentlichkeit wurden keine tragfähigen Argumente für den Krieg geliefert; außerdem hätte man ihr vermitteln müssen, dass Opfer erforderlich sind – Amerika muss unabhängig werden von importiertem Öl, und hohe Steuern sind notwendig, um die ökonomische Grundlage für unseren Wohlstand und für den Krieg gegen den Terror aufrechtzuerhalten.
Die von der Regierung entwickelte weitreichende Vision der Rolle Amerikas in der Welt und seiner moralischen Verantwortung beruht auf einer gerechtfertigten Annahme: Es ist wahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten ihre Weltmachtposition noch für lange Zeit beibehalten werden. In den Worten von George W. Bush: 60 Jahre, in denen die westlichen Nationen den Mangel an Freiheit im Nahen Osten entschuldigt und geduldet haben, haben nicht zu unserer Sicherheit beigetragen.“ Anders als das britische Imperium vor 100 Jahren sind wir kein „müder Titan“. Doch unsere Fähigkeit, unsere Macht so einzusetzen, dass die gewünschten Ergebnisse herauskommen, bleibt chaotisch und unvollkommen.
Lässt sich die Bush-Doktrin aufrechterhalten? Letzten Endes ist das keine Frage des Geldes oder des Personals, sondern eine Frage des politischen Willens. Die Hauptsorge ist, ob die Öffentlichkeit angesichts der schmerzlichen Verluste an Menschenleben (auch wenn die Zahl der Getöteten geringer ist als in früheren Konflikten) der langen, anhaltenden Kämpfe ohne Aussicht auf ein Ende nicht überdrüssig werden wird. Ein weiteres Problem sind unsachliche und einseitige Sichtweisen, die als objektive Beschreibungen angesehen werden, gepflegt nicht nur von den Chomskys, Michael Moores und Buchanans, sondern auch von seriöseren Autoren, Journalisten und Wissenschaftlern. Viele dieser negativen Urteile über die Bush-Doktrin speisen sich aus einer tiefen politischen und kulturellen Antipathie gegen die Präsidentschaft Bushs.
Diese Abneigung wäre nicht so schlimm, würde sie nicht auch von einem großen Teil der politischen Elite im Umfeld der Demokratischen Partei geteilt. Früher oder später wird das politische Pendel die Demokraten wieder an die Regierung befördern. Freilich gibt es unter ihnen auch einige Persönlichkeiten und Amtsinhaber, die nicht so sehr von verletzter Eitelkeit und politischem Wunschdenken besessen sind, dass sie die Kosten und Gefahren der Lage nach dem 11. September unterschätzen würden. Doch diese sind in der Minderheit. Die Energie und die Aktivitäten der Partei gehen in eine andere Richtung.
PAUL BERMAN ist Mitarbeiter der Zeitschrift New Republic und writer in residence der New York University. Zuletzt sind von ihm erschienen „Terror und Liberalismus“ (2004) und „Power and the Idealists: Or, the Passion of Joschka Fischer
and Its Aftermath“ (2005).
FRANCIS FUKUYAMA, geb. 1952, ist Professor für Internationale Politische Ökonomie an der Johns Hopkins University, Washington DC. Zuletzt ist von ihm erschienen „State-Building: Governance and World Order in the 21st Century“ (2004).
VICTOR DAVIS HANSON, geb. 1953, ist Althistoriker und Senior Fellow bei der Hoover Institution, Stanford. Sein jüngstes Buch ist „A War Like No Other: How the Athenians and Spartans Fought the Peloponnesian War“ (2005).
ROBERT J. LIEBER ist Professor für Regierungslehre und Internationale Politik an der Georgetown University, Washington D.C. Zuletzt ist von ihm erschienen „The American Era: Power and Strategy for the 21st Century“ (2005).
Internationale Politik 1, Januar 2006, S. 22 - 30.