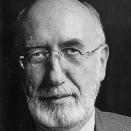Das Ende des „Westens“
Tabus in den transatlantischen Beziehungen
Der Krieg in Irak hat eine Diskussion in Gang gebracht, die nach den Zielen und Motiven einer amerikanischen Außenpolitik fragt, welche weder durch das Regelwerk der Vereinten Nationen noch durch Ressourcenmangel und schon gar nicht durch Rücksichtnahme auf Partner gebremst wird. Aus der Sicht Heinrich Vogels hat der Versuch, die NATO für Zwecke der amerikanischen Suprematie zu instrumentalisieren, dazu geführt, dass es den „Westen“ im herkömmlichen Sinn nicht mehr gibt.
Der Krieg in Irak hat eine Diskussion in Gang gebracht, die nach den Zielen und Motiven einer amerikanischen Außenpolitik fragt, welche weder durch das Regelwerk der Vereinten Nationen noch durch Ressourcenmangel und schon gar nicht durch Rücksichtnahme auf Partner gebremst wird. Die Tatsache, dass das Bündnis unter dem Druck der Irak-Krise in je eine Koalition der Willigen und der Unwilligen zerfiel, kennzeichnet den Preis der Aktion: Der Versuch der Instrumentierung der NATO für Zwecke der amerikanischen Suprematie hat die Substanz der Zusammenarbeit ausgehöhlt. Den „Westen“ im herkömmlichen Sinn gibt es nicht mehr. Es gehört zu den Paradoxien der gegenwärtigen Lage, dass gerade die Demonstration absoluter militärischer Macht den politischen Führungsanspruch der USA so weit beschädigt hat, dass nunmehr offen über die Konditionen der weiteren sicherheitspolitischen Zusammenarbeit gesprochen werden muss.
Eine solche Feststellung wird teilweise immer noch als Tabubruch angesehen. Bündniskonservative unterschätzen jedoch die neue Qualität in den transatlantischen Beziehungen, wenn sie der protestierenden Öffentlichkeit im „alten Europa“ und vor allem in Deutschland das Totschlagargument des Antiamerikanismus entgegenhalten. Dies trifft nur zum Teil. Sicher haben die im „linken Lager“ und bei großen Teilen der älteren Generation aus DDR-Zeiten konservierten Einstellungen gegenüber „den Amerikanern“ und eine traditionelle kulturelle Überheblichkeit neuen Aufwind erhalten. Solche Stereotypen erklären jedoch nicht das Ausmaß der Proteste, die weit über jenes traditionell antiamerikanische Spektrum hinausreichen und von tiefer Enttäuschung getragen sind.
Die zielstrebige Vorbereitung der Invasion in Irak hat den Zugewinn an Sympathie und Bereitschaft zur Kooperation mit den Vereinigten Staaten, den die Ereignisse des 11. Septembers 2001 in einer spontanen weltweiten Solidarisierung gebracht hatten, zu einem großen Teil wieder aufgezehrt. Die Manifestationen vor allem in Deutschland jetzt als „Gutmenschentum“ und „Lichterkettenpolitik“ zu karikieren, heißt, sie in ihrer politischen Dynamik zu unterschätzen, denn sie sind Teil einer breiten europäischen Öffentlichkeit, der der Glaube an die Wertegemeinschaft mit der amerikanischen Außenpolitik abhanden gekommen ist. Moralisierende Appelle, mit denen das alte Gefolgschaftsverhältnis wieder hergestellt werden soll, können solche Schäden nicht beheben. Die Manipulationsfunktion der Vorwürfe an die „alten Europäer“ war zu deutlich und der Zynismus der transatlantischen Rhetorik nicht zu übersehen, mit der die Europäer in eine Koalition der Dankbaren gepresst werden sollten.
Neben den von vermuteten irakischen Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren spielten historische Analogien eine zentrale Rolle im amerikanischen Kaleidoskop der Rechtfertigungen. Der Hinweis auf das Schicksal des Völkerbunds argumentierte mit der Rettung des Ansehens der Vereinten Nationen, und der Vergleich Saddam Husseins mit Adolf Hitler begründete eine historische Pflicht zur humanitären Intervention gegen Terrorregime – ein Hinweis, der besonders auf die Kritik aus Deutschland zielte.
Unterminiertes Vertrauen
Im Endeffekt unterminierten jedoch der ständige Argumentationswechsel und die Beweisnot bei den Behauptungen, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen und arbeite aktiv mit der Terrororganisation Al Khaïda zusammen, das Vertrauen in die amerikanische Außenpolitik. Im Rückblick wird überdeutlich, dass diese Außenpolitik nicht mehr die des Marshall-Plans, der Luftbrücke und jenes demokratischen Aufbaus ist, mit denen Nachkriegseuropa stabilisiert und gegen die pseudohumanistische Propaganda des „real existierenden Sozialismus“ immunisiert wurde.
Aber auch die Innenpolitik der USA hat sich in Richtung auf ein System von „checks without balances“ verändert. Autoritätsgläubigkeit und wachsende Militarisierung der Leitbilder der amerikanischen Gesellschaft erinnern eher an schwächliche bzw. manipulierte Demokratien wie die Weimarer Republik oder die Russische Föderation von heute. Jedenfalls drängen sich unangenehme Fragen auf, die nicht länger mit einem Tabu belegt werden dürfen:
–Wie glaubwürdig ist eine Demokratie, deren Präsident durch Wahlmodalitäten an die Macht kam, die kein Wahlbeobachterteam der OSZE in den so genannten „neuen Demokratien“ Ostmittel- und Osteuropas ungerügt gelassen hätte?
–Wie viel Vertrauen verdienen noch die Institutionen dieser Demokratie, wenn es einer Regierung gelingen kann, die parlamentarisch-demokratischen Kontrollen für die Kündigung einer tragenden Säule der Sicherheitspolitik, des ABM-Vertrags, und den Einsatz militärischer Gewalt in Irak mit einer Art Ermächtigungsgesetz auszuhebeln?
–Wo verlaufen die Grenzen der Manipulierbarkeit, wenn allein die hypnotisierende Wiederholung amtlicher Desinformation ausreicht, fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung glauben zu machen, Irak unterhalte direkte Verbindungen zu Al Khaïda und sei folglich für die Terrorakte des 11.September 2001 mitverantwortlich?
–Ist die Kluft zwischen einer unübersehbaren Mehrheit kritisch-selbstbewusster Demokraten in Europa und einer in patriotischem Konformismus gefangenen amerikanischen Gesellschaft noch überbrückbar? Diese Problematik wird mit der Metapher vom Unterschied zwischen „Mars und Venus“ nicht nur verniedlicht, sondern schlicht verfehlt.
Nicht erst mit der Emotionalisierung nach dem 11. September1 ist in den Vereinigten Staaten eine Gesellschaft entstanden, die sogar an das Wilhelminische Deutschland vom Vorabend des Ersten Weltkriegs erinnert. Der mit immensem Medienaufwand betriebene Kult der Präsidentschaft entwickelt eine peinliche Ähnlichkeit mit jener vordemokratischen Phase deutscher Geschichte, bedingungsloser Patriotismus verwischt die Unterschiede im Profil der politischen Parteien, und die Versuche zu einer ernsthaften parlamentarischen Diskussion der Sicherheitsgesetze und der Militarisierung der Gesellschaft geraten in den Geruch mangelnder politischer Korrektheit.
Hätte es „9/11“ nicht gegeben, eine Wiederwahl dieses Präsidenten und die Fortsetzung seiner neokonservativen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik wären wenig wahrscheinlich. Zwei Jahre Wachstumsrückgang in der amerikanischen Wirtschaft, wachsende soziale Spannungen und der massive, von Megaskandalen ausgelöste Vertrauensverlust auf den Finanzmärkten hätten einen Stimmungsumschwung und eine demokratische Präsidentschaft erwarten lassen. Dass der Terroranschlag des „9/11“ in dieser Perspektive den Neokonservativen eine nicht unwillkommene Handhabe zur kompromisslosen politischen Instrumentierung bot, wird gern übersehen.2
Ideologische Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen von Neokonservativen sollten nicht überschätzt werden, denn in der Außen- und Sicherheitspolitik finden kühle Machtpolitiker ebenso wie evangelikale Fundamentalisten am leichtesten den gemeinsamen Nenner. Zur Diskussion stehen bestenfalls taktische Varianten, nicht aber das neokonservative Programm, das seinen Niederschlag in der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ vom 17. September 2002 gefunden hat. Offene Imperialisten, Unilateralisten und Nationalisten sind zwar durch den unbedingten Willen zur Sicherung der politischen, militärischen und ökonomischen Suprematie der USA geeint,3 die Dominanz der imperialistischen Denkschule aber ergibt sich unmittelbar aus der Rolle ihrer führenden Vertreter in der Regierung.4
„Opinion Management“
Die Apparate der Neokonservativen, Think-Tanks wie die Heritage Foundation, und ihre Netzwerke unternehmen mit großem Geschick die Steuerung der öffentlichen Meinung (Opinion Management), indem sie abweichende Meinungen in teuren Kampagnen diskreditieren und die eigenen Vordenker in Schlüsselfunktionen bringen. Zur verfassungs- und rechtspolitischen Verfestigung der neokonservativen Positionen trägt nicht zuletzt die bedenkliche Schwäche der Demokratischen Partei bei, die weder einen überzeugenden Gegenkandidaten für George W. Bush präsentiert noch ein Rezept gegen die Mobilisierungsstrategie des „War Against Terror“ mit ihren fatalen Versuchungen gefunden hat. Ohnehin sollten die Demokraten in ihrem Willen zum außenpolitischen Kurswechsel nicht überschätzt werden; das Problem des völkerrechtlichen Autismus der Hypermacht, die sich praktisch allen multilateralen Vertragswerken von zentraler Bedeutung für die internationale Sicherheit (von ABC-Waffen über Landminen, Kyoto-Protokoll bis hin zum Internationalen Strafgerichtshof) verweigert,5 ist älter als die amtierende Regierung.
Entfremdung
All dies spiegelt die tiefer reichende Entfremdung zwischen den USA und Europa: dort außenpolitischer Exzeptionalismus, zunehmend inspiriert vom manichäischen Weltbild christlicher Fundamentalisten, hier andererseits ein gesellschaftliches Leitbild, dessen säkulares Selbstvertrauen auf die Macht des vernünftigen Arguments baut. Wieweit noch generalisierend von einer Wertegemeinschaft gesprochen werden kann, ist fraglich.
Es bedarf einer gehörigen Portion an resigniert-aufgeklärtem Zynismus – die politische Theorie nennt es auch „Realismus“–, um die beschriebenen Veränderungen als Zeichen der Zeit zu akzeptieren und die Bemühungen um ein leistungsfähigeres und dabei konsensgestütztes internationales System einzustellen. Schließlich ist eine Sicherheitsdoktrin brandgefährlich, die den Anspruch erhebt, die Probleme der Proliferation von Massenvernichtungswaffen und des Terrorismus durch präventiven Einsatz militärisch überlegener Mittel gegen Schurkenstaaten zu lösen. Denn gerade der Erfolg der militärischen Ersatzhandlungen veranlasst staatliche Akteure wie Nordkorea nur zu verstärkten Anstrengungen, solche Waffen zu erwerben. Neue militärische Interventionen wären die logische Konsequenz.
Ungeachtet aller nationalen Anstrengungen mit Programmen wie „Homeland Security“ oder „Total Information Awareness“ und des verfrühten Jubels über den „Sieg in Irak“ bleiben die Vereinigten Staaten jedoch auf die Unterstützung gleich motivierter und kompetenter Partner angewiesen, denn es dürfte sich sehr schnell erweisen, dass die Methode des militärischen „Shock and Awe“ die Gefährdung der gemeinsamen Sicherheit nur an der Oberfläche reduziert und tragfähige Problemlösungen weiter in die Zukunft verschiebt. Wechselseitige Abhängigkeit ist nun einmal das geopolitische Grundmuster,6 das auch von der „einzigen verbliebenen Supermacht“ nicht ohne negative Konsequenzen ausgeblendet werden kann; transnationale Terrororganisationen werden nur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitsapparate unschädlich gemacht und „failing states“ nur mit einem überzeugenden längerfristigen Konzept des „nation building“ konsolidiert werden können.
Auch beim unerlässlichen „peacekeeping“, zu dem amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik wegen der Gefahr der imperialen Überdehnung und des traditionell geringen Interesses der politischen Eliten nur bedingt bereit ist, bleibt der Hegemon von Alliierten abhängig, die diesen Teil der Stabilisierung übernehmen – eine Aufgabe, die wegen des geringen Medienechos für nichtspektakuläre, d.h. nichtmilitärische Aktionen im Allgemeinen unterschätzt wird.
Führungsanspruch
Ein weiterer Ansatzpunkt, über dessen Aktivierung laut nachzudenken lohnt, liegt wieder in einer Tabuzone der transatlantischen Beziehungen: Welchen Wert hat eine Kooperation mit den USA, die den UN-Inspekteuren in Irak die nachrichtendienstliche Unterstützung bei der Suche nach Massenvernichtungsmitteln verweigern, während sie ihren kommunikationstechnischen Vorsprung für die wirtschafts- und industriepolitische Ausspähung der europäischen Verbündeten ausnutzen? Das in amerikanischen Beweisführungen schon immer gern verwendete Argument „If you knew what I know“ ist spätestens mit dem Offenbarungseid des stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz über die Hintergründe der Entscheidung Washingtons, das Vorhandensein von Massenvernichtungsmitteln zum zentralen Argument des Auftritts von Außenminister Colin Powell im Sicherheitsrat zu machen,7 nicht mehr akzeptabel. Die Europäer sind gut beraten, sich lieber auf eigene Quellen zu verlassen.
Im Zusammenhang mit ihrer Kritik an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Türkei formulierte die amerikanische Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice eine Regel: „Niemand sollte die NATO als Geisel nehmen“. Dabei bleibt die Frage unbeantwortet, wie denn ernsthaft mit der Notwendigkeit der kollektiven Verteidigung argumentiert werden konnte, wenn erst die militärische Aggression von NATO-Mitgliedern gegen einen Nachbarstaat der Türkei den Beistandsfall auslösen sollte? Auch die offen geäußerte Erbitterung des stellvertretenden Verteidigungsministers Wolfowitz über mangelnde politische Führungsfähigkeiten des türkischen Militärs angesichts der ablehnenden Haltung des Parlaments in Ankara8 lässt tief blicken; ganz offensichtlich hätte er eine willfährige Militärregierung den Ansätzen zu einem neuen Parlamentarismus in der Türkei vorgezogen.
Angesichts solcher Vorstellungen bedürfen die militärische Konzeption der Sicherheitspolitik und die Herabstufung der NATO zum Werkzeugkasten für weltweite Optionen des Hegemons9 der Korrektur: Es wird Zeit, die transatlantische Kooperation stärker auf die nichtmilitärische Bekämpfung von Terrorismus, Proliferation und grenzüberschreitender Kriminalität zu konzentrieren und in jedem Fall auf Gleichberechtigung und Reziprozität der Informationsflüsse zu bestehen.
Der erhebliche Vertrauensverlust bei den Verbündeten der USA, der durch das Insistieren Washingtons auf der Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen entstanden ist, wird durch die Logik amerikanischer Rückzugsargumente noch vergrößert: Wenn die Existenz dieser Waffen durch ihre Nichtauffindbarkeit nicht widerlegt wird, dann wäre ja auch das Verschwinden von Saddam Hussein und Osama Bin Laden als Beweis für die Zusammenarbeit Iraks mit Al Khaïda zu werten. Glaubensstärke allein genügt fortan nicht mehr. Die Verantwortung dafür, ob die NATO weiterhin den Rahmen für das gesamte Spektrum der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA liefern kann, oder ob nach einer distanzierteren Form der transatlantischen Kooperation gesucht werden muss, liegt in Washington.
Vor die Wahl gestellt, entweder der Vision eines nach Immanuel Kants Vorstellungen geformten Systems der internationalen Beziehungen zu folgen oder aber für die Hobbessche Welt der Selbstbedienung des Stärkeren zu optieren, können sich die Europäer nicht länger hinter den rituellen Mantras von transatlantischer Wertegemeinschaft und sicherheitspolitischer Gemeinsamkeit verstecken. Der Appell, die „vertrauensvolle Partnerschaft fortzusetzen“,10 trägt nicht mehr angesichts der unverhüllten Absicht der Regierung Bush, Europa auf den Primat einer amerikanischen Strategie des „freedom from attack and freedom to attack“ einzuschwören. Die Wunschträume von einer Rückkehr zu alten Standards werden schnell zerrinnen, denn das „Project for a New American Century“ dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit in einer weiteren Legislaturperiode des George W. Bush vorangetrieben werden.
Reibungsverluste
Anhänger des Realismus in der Analyse der internationalen Beziehungen täuschen sich, wenn sie militärische und technologische Überlegenheit zum alleinigen Maßstab der Macht erheben. Früher war die amerikanische Bündnispolitik klug genug, ungeachtet der längst uneinholbaren Asymmetrie der Ressourcen wenigstens den Anschein von Gleichberechtigung zwischen den Partnern zu wahren. Gerade in der Kombination militärischer und technologischer Überlegenheit mit Soft Power (in Joseph Nyes Worten: „attraction rather than coercion“11) wurde amerikanische Führung produktiv. Der Verzicht auf dieses Instrumentarium lässt die Reibungsverluste überhand nehmen.
Die Akzeptanz der Gleichsetzung von Macht mit militärtechnologischer Überlegenheit kommt der Kapitulation Europas gleich, da eine Steigerung der Rüstungsausgaben, die auf die Schließung der „geostrategischen Lücke“ gegenüber den USA zielte, die finanziellen und politischen Ressourcen des heutigen Europa überfordern würde. Bei dieser Argumentation wird jedoch übersehen, dass die militärische Abhängigkeit Europas ohne erheblichen finanziellen Mehraufwand reduziert werden kann, indem Potenziale zusammengeführt und durch gemeinsame Planung besser genutzt werden. Das Projekt einer europäischen Verteidigungsunion geht hier in die richtige Richtung.
Dass das erste Echo aus Washington auf diesen Schritt nicht positiv ausfiel, sollte durchaus als Bestätigung für diesen Ansatz aufgefasst werden. Auch die Tatsache, dass die innereuropäische Kontroverse um die Unterstützung der militärischen Intervention in Irak durch amerikanische Entwürfe für die Briefe der „Acht“ und der „Zehn“ inspiriert wurde,12 lässt erkennen, wie es um das Interesse der USA an einem stärkeren Europa bestellt ist.
Was die längerfristigen Alternativen der europäischen Außenpolitik betrifft, so hat Fareed Zakaria hoffentlich Recht, wenn er feststellt, dass „operating in a conspicuously unconstrained way, in service of a strategy to maintain primacy, will paradoxically produce the very competition it hopes to avoid“.13 Aber es genügt nicht, dialektisch darauf zu vertrauen, dass fortgesetzte amerikanische Intransigenz die Europäische Sicherheits- und Außenpolitik sozusagen durch die Hintertür in belastbare Strukturen zwingen wird. Andererseits wäre es fatal, die Vision einer erhofften Weltrolle der EU mit den heutigen Optionen der europäischen Politik zu verwechseln. Weder brüchige Achsenkonstruktionen unter Einbeziehung von Halbdemokratien wie Russland noch metaphorische Betrachtungen über die Natur der transatlantischen Differenzen werden das Defizit an politischer Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union beseitigen.
Nur konsequenter Arbeit an der Verbesserung der Leistungsfähigkeit Europas und einer selbstbewussten und dabei kooperativen Argumentation nach außen wird es gelingen, das transatlantische Verhältnis ausgeglichener zu gestalten. Kurzfristig kommt es deshalb darauf an, im politischen Dialog mit den USA weiter jenen Wertekatalog einzufordern, der einmal Grundlage der transatlantischen Beziehungen war. Die Risiken und Nebenwirkungen der amerikanischen Politik müssen zwar offen angesprochen, die unvermeidlichen Auseinandersetzungen aber über diplomatische Kanäle geführt werden, wenn die Emotionen nicht weiter angeheizt werden sollen.
Festhalten am Konsensprinzip
Die kurzfristige Agenda der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik ist durchaus realistisch: Das Festhalten am Konsensprinzip wird die NATO stärken, die europäische Militärtechnik kann nicht nur im Transportsektor, sondern auch in den für die USA unverzichtbaren Komponenten (AWACS, ABC-Abwehrtechnik) weiter entwickelt werden, und im Rahmen der Verteidigungsunion kann ein gemeinsames Kommando für Luftwaffe und Marine etabliert werden, das auch die übrigen EU-Mitglieder einbezieht. Darüber sollte nicht vergessen werden, dass die gemeinsamen europäischen Brigaden bereits zu eigenständigen humanitären Einsätzen durchaus fähig sind.
Im Gegensatz zur geostrategischen Position der Vereinigten Staaten ist deren geopolitische Überlegenheit durchaus angreifbar. Europäische Potenziale in der Handels-, Währungs-, Technologie-, Rechts- und Kulturpolitik relativieren den amerikanischen Führungsanspruch ganz erheblich. Im Kontext der WTO, des Kyoto-Prozesses und ganz allgemein bei der Verteidigung europäischer Rechtsstandards gilt es, die europäischen Interessen zu vertreten und die Lähmung des politischen Willens durch einen larmoyant-romantischen Atlantizismus zu überwinden, der nur das Propagandabild von der amerikanischen Allmacht transportiert. Zu Kleinmut besteht jedenfalls kein Anlass.
Anmerkungen
1 Vgl. Philipp S. Müller, Die Außenpolitik der USA und der 11. September, SWP-Zeitschriftenschau (Stiftung Wissenschaft und Politik), Januar 2002.
2 Verbürgt ist die kühle Schlussfolgerung der Sicherheitsberaterin des amerikanischen Präsidenten, Condoleezza Rice: „Let’s capitalize on it.“
3 Der geopolitische Konsens ist nachzulesen in den Memoranden des „Project for a New American Century“ <http://www.newamericancentury.org>.
4 Vgl. hierzu den Überblick bei Till Leopold, Anatomie der amerikanischen Kriegslobby, in: antimilitarismus information (ami), 33. Jg., Heft 1–2, Januar/Februar 2003, S. 5–18.
5 Vgl. Rule of Power or Rule of Law? Institute for Energy and Environmental Research and Lawyers’ Committee on Nuclear Policy, New York 2003.
6 Vgl. Karl Kaiser, Zeitenwende. Dominanz und Interdependenz nach dem Irak-Krieg, in: Internationale Politik, 5/2003, S. 1–8.
7 Wolfowitz Comments Revive Doubts Over Iraq Weapons, in: New York Times (unter Bezug auf AP vom 30.5.2003.
8 Vgl. Marc Lacey, Turks reject US criticism of opposition to Iraq war, in: New York Times, 7.5.2003.
9 Vgl. Ulla Jasper, Europa, die USA und die NATO – Die Militarisierung der amerikanischen Außenpolitik, Friedrich Ebert Stiftung, Internationale Politikanalyse, Dezember 2002, S. 20 ff.
10Vgl. Wolfgang Schäuble, Lektionen aus der Krise, in: KAS/Auslandsinformationen, Heft 4/2003, S. 12.
11Vgl. hierzu Joseph S. Nye, The Velvet Hegemon – How soft power can help defeat terrorism, in: Foreign Policy, Mai/Juni 2003, S. 74–75.
12Vgl. The rift turns nasty: the plot that split old and new Europe asunder, in: Financial Times, 28.5.2003.
13 Vgl. The Arrogant Empire, in: Newsweek, 24.3.2003.
Internationale Politik 6, Juni 2003, S. 27 - 34