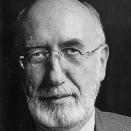Von der Völker- zur Männerfreundschaft?
Über den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen
Große Teile der russischen Gesellschaft sind in Bewegung. Es wäre verhängnisvoll, sie weiter den Manipulationen einer machtversessenen Elite in Moskau auszuliefern – aber genau dies geschieht, wenn westliche Staatsführer, statt deutliche Kritik an der autoritären Politik des Kremls zu üben, aus taktischen Gründen Wladimir Putin umschmeicheln.
Die Bilanz der deutsch-russischen Beziehungen im Jahr 2005 ist unbefriedigend, denn eine freundschaftliche Normalität auf breiter Basis, wie sie nach dem Ende des Kalten Krieges möglich erschien, hat sich nicht realisieren lassen. Die Spätfolgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion klingen zwar ab, aber das Klima wird weiter durch die Echos jahrzehntelanger ideologischer Konfrontation und mehr oder weniger friedlicher Koexistenz belastet. Die von russischer Seite häufig gestellte Diagnose einer ungebrochenen Kalte-Kriegs-Mentalität bei deutschen Eliten reicht jedoch nicht aus, die Stagnation in den zwischengesellschaftlichen Beziehungen adäquat zu beschreiben.
Engagierte Bürger beider Staaten haben immer wieder versucht, den Spielraum für spontane Kooperationen zu erweitern. Auf der zwischenstaatlichen Ebene jedoch wurde die künstliche Völkerverständigung der späten Sowjetzeit durch kaum mehr als gemeinsame Medienevents und eine demonstrative Männerfreundschaft der Staatsführer ersetzt. Bezeichnend für diesen Zustand der politischen Beziehungen sind der genervt-vorwurfsvolle Unterton russischer Verlautbarungen und die bemühte Sprachregelung offizieller deutscher Stellungnahmen, die immer wieder Trost im Rückblick auf den seit 1990 zurückgelegten Weg suchen. Eine Entkrampfung wird so lange auf sich warten lassen, wie die politische Führung Russlands antiquierte Großmachtambitionen kultiviert und zugleich an ihrem misstrauischen Kontrollanspruch gegenüber der eigenen Bevölkerung festhält. Mitverantwortlich für die unübersehbare Stagnation der Demokratisierung Russlands sind aber zweifellos auch die Regierungen Deutschlands und des übrigen Westens, die sich im Rahmen der G-8 mit Deklarationen und Akten symbolischer Politik von Seiten Russlands begnügten.
Die wechselseitigen Perzeptionen bleiben unscharf. Die Führung in Moskau behauptet, weiter entschlossen zu sein, die Demokratie in Russland zu fördern, auch wenn die meisten Beobachter seit der Wiederwahl Putins übereinstimmend die Verfestigung eines autoritären Systems feststellen. Die Führer der G-7-Staaten blieben zumindest bis zum Gipfel von Bratislava im März 2005 bei ihrem rituellen Lob für die politische Normalisierung und wirtschaftliche Stabilisierung Russlands, vor allem aber für die Kooperation im Kampf gegen den Terrorismus. Dieses ungebrochen positive Urteil gründet auf einer Feststellung und einer Hypothese: Die innenpolitische Entwicklung mag zwar nicht völlig demokratisch verlaufen, aber sie führt wenigstens nicht zurück in kommunistische Verhältnisse; das unausbleibliche Anwachsen der bürgerlichen Mittelklasse aber wird den Trend in Richtung Freiheit und Demokratie absichern – zumindest langfristig.
Auch wenn die offiziellen Vorstellungen von den künftigen Beziehungen mit Russland grundsätzlich optimistisch klingen, so bleiben die großen „Partnerschaften“ und „Gemeinsamen Räume“ doch relativ blass, zumal es auf westlicher Seite an zielgerichteter Koordinierung in der konkreten Ausgestaltung mangelt. Komplizierende Fragestellungen zur langfristigen Sicherheitspolitik bleiben zugunsten der ungestörten Inszenierung von Gipfeltreffen möglichst ausgeklammert. Andererseits verdecken die Personalisierung der Außenpolitik, feurige Bekenntnisse zu gemeinsamen Werten und der inflationäre Gebrauch des Adjektivs „strategisch“ die eigentlichen Motive im innerwestlichen Wettbewerb um einen potenziell riesigen Markt.
Déjà-vu-Erlebnisse
Dieses Umfeld erklärt auch den Erfolg der russischen Außenpolitik. Die Vertreter der herrschenden Sicherheitsdienste in Moskau brüsten sich mit demokratischen (wenn auch an russischen Traditionen orientierten) Fortschritten und der Stabilisierung von Wirtschaft und Staat als Garantie einer ungestörten Kooperation. Der russische Präsident genießt die Solidarität der internationalen Allianz gegen den Terror und benutzt sie als Passepartout für zweifelhafte antiterroristische Operationen und Korrekturen an der Jelzin-Verfassung. Die Ideale des starken Staates und der Diktatur des Gesetzes werden als unabdingbare Bestandteile eines „russischen Weges“, zugleich aber als kompatibel mit „europäischen“ Standards stilisiert.
Andererseits reaktiviert man die Instrumente, mit denen schon die sowjetische Diplomatie repressive Praktiken verteidigte: Die Abwehr von „Einmischung in innere Angelegenheiten“ und der Vorwurf westlicher Doppelstandards gipfeln in der These einer gewohnheitsmäßigen antirussischen Einstellung („Russia-bashing“) des Westens. Auch der Mythos von den ungeheuren Energieressourcen und einer zu Höchstleistungen fähigen Forschung gehört nach wie vor zum Standardprogramm russischer Selbstdarstellung gegenüber westlichen Partnern, obwohl eine im internationalen Vergleich ungünstige Kostenstruktur bei der Ausbeutung der Lagerstätten und die geringe internationale Wettbewerbsfähigkeit russischer Technologien diese Bewertung kaum rechtfertigen.
Vor allem aber gelang es der russischen Außenpolitik, den traditionellen Wettbewerb zwischen den westlichen Regierungen um privilegierten Zugang zum Kreml in Gang zu halten, indem sie die Wirtschaftsbeziehungen im Stil der Ost-West-Politik der siebziger Jahre politisierte. Wirtschaftsbeziehungen sind wie damals Chefsache, und bühnenreife Umarmungen der Staatsführer mit Putin signalisieren allerhöchste Protektion für die aktuellen Großgeschäfte. Die langfristigen Nebenwirkungen dieses Verhandlungsstils – die Zementierung reaktionärer Geschäftspraktiken und einer für Petrostaaten typischen Verflechtung von Wirtschaft und Politik – treten hinter dem kurzfristigen Verhandlungserfolg zurück. Diese Kombination russischer Fassadenmalerei im Stil Potemkins mit westlichem Wunschdenken birgt jedoch erhebliche Risiken, die nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert werden.
Das weniger attraktive Szenario
Der von der Verfassung geforderte Wechsel im Präsidentenamt (Moskauer Eliten sprechen vom „Projekt 2008“) stellt eine neuerliche Wasserscheide für die Zukunft des politischen Systems in Russland dar. Das folgende Szenario – nicht einmal das negativste aus einem breiten Spektrum von Zukunftsalternativen – kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden:
Die politischen Technologen des Kremls managen die Präsidentenwahl nach der bewährten Methode von 2000; schließlich stehen ihnen alle Instrumente zur administrativen Kontrolle und Feinsteuerung der Gesetzgebung zur Verfügung, um jeden Versuch zur Organisation abweichender Meinung, geschweige politischer Opposition, im Ansatz zu ersticken. Gefügige Gerichte sichern den rechtsstaatlichen Schein. Die angesichts schmerzhafter Reformen der sozialen Sicherungssysteme und kommunaler Dienste wachsende Unruhe beim Wahlvolk wird durch patriotische Appelle gedämpft, und zur Not sorgt auch ein rechtzeitiger Terroralarm für jenes Klima der Angst, in dem Kritik zum Hochverrat wird.
Selbst wenn man der Hypothese zuneigt, Russland sei bereits ein „normales“, d.h. wenigstens im Kern demokratisches Land, gibt es keinen plausiblen Grund für die Annahme, die regierende Junta werde sich angesichts solcher Rahmenbedingungen freiwillig dem Risiko freier und fairer Wahlen aussetzen. Wenn das obige Szenario auch nur einen Hauch von Realismus besitzt, müssen sich westliche Regierungen auf die Möglichkeit weniger kalkulierbarer, unter Umständen auch weniger kooperativer Beziehungen mit Russland einstellen.
Keine verantwortungsbewusste langfristige Außen- und Sicherheitspolitik kann jedoch künftige Entwicklungen ausschließen, die außerhalb der Vorstellungswelt des reinen Wunschdenkens liegen. Kurzfristig erscheinen die Strukturen und Trends der russischen Innenpolitik autonom, zumal jeder Versuch direkter Einflussnahme von außen als illegitim denunziert werden kann. Es wäre jedoch verhängnisvoll, jene Grundannahme ungeprüft zu übernehmen, wonach sich Russland langfristig auf einem eigenen (sprich „russischen“), für Vorstellungen und Erwartungen der Außenwelt unerreichbaren Entwicklungspfad befindet und schon aus Gründen der energie- und rohstoffpolitischen Abhängigkeit mit Vorsicht behandelt werden sollte. Befürworter dieser als Strategie verkleideten Kapitulation warnen sogar davor, „Putin zu reizen“.
Zwei Überlegungen lassen Schwachstellen des bis heute in Russland entstandenen politischen Systems erkennen, an denen sich langfristig durchaus Einflussmöglichkeiten für westliche Politik eröffnen:
- Keine Führung in Moskau kann die Zeitverluste vermeiden, die zwischen technisch leicht durchsetzbaren Entscheidungen für Strukturreformen einerseits und deren Realisierung mit den entsprechenden Wachstums-, Beschäftigungs- und Modernisierungseffekten andererseits auftreten. Diese politischen Transaktionskosten wachsen mit dem Maß der Bürokratisierung und Korrumpierung des politischen Systems. Die aufgestauten Erwartungen der Bürger und Verbraucher können nur für begrenzte Zeit durch Akte symbolischer Politik abgefedert werden, in denen sich die russische Führung als globaler Akteur feiern lässt. Die sprichwörtliche Geduld der russischen Gesellschaft sollte nicht als unbegrenzt unterstellt werden, zumal westliche Standards politischer Legitimität über beträchtliche Ausstrahlung verfügen.
- Das Risiko einer politisch-ökonomischen Verwundbarkeit – häufig als Begleiterscheinung wachsender europäischer Energieimporte aus Russland angeführt – gilt auch für den Exporteur selbst. Russland ist auf absehbare Zeit auf die Einnahmen aus diesen Lieferungen angewiesen, gleichzeitig aber deutlich weniger als die westlichen Partner in der Lage, seinen Importbedarf bei Industrieerzeugnissen und Technologien durch eigene Diversifizierung und Innovation zu steuern. Der Wettbewerbsvorteil größerer Flexibilität für die westlichen Staaten liegt auf der Hand.
Diese fundamentale Logik der „wechselseitig gesicherten Abhängigkeit“ spricht für die Annahme eines Systems rationaler Entscheidungen, in dem die Strukturdefizite und die Integration der russischen Wirtschaft in die Weltwirtschaft die häufig unterstellte Option der Kooperationsverweigerung entwerten. Andererseits gehen auch Forderungen nach einer Verknüpfung der wirtschaftlichen Kooperation des Westens mit politischen Forderungen an der russischen Realität vorbei. Vorwürfe wegen Nachgiebigkeit bei der Behandlung des Tschetschenien-Problems („Schweigen im Austausch für russisches Gas“) implizieren die Annahme, westliche Politik müsse nur mutiger und konsequenter auftreten, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Dabei wird übersehen, wie verfahren die Situation im Kaukasus mittlerweile ist. Ohne Hilfestellung von außen bleibt die immer wieder geforderte und von Moskau auch versprochene „politische Lösung“ reine Utopie.
Ungeprüfte Optionen
Die politischen Eliten Russlands sind heute mehr denn je auf Anerkennung von außen, auf politische Zusammenarbeit, zumindest auf den Anschein gleichberechtigter Normalität in den internationalen Beziehungen angewiesen, denn die Erfolgsdefizite der Innen- und Gesellschaftspolitik haben den Glauben an die Allmacht des Kremls weitgehend aufgezehrt. Diese Konstellation verleiht dem Instrument der offenen Ansprache kritikwürdiger Entwicklungen eine völlig neue praktische Bedeutung, ohne den unfruchtbaren Gegensatz von Real-politik und Prinzipientreue zu bemühen. Westliche Staatsführer, voran der deutsche Bundeskanzler, unterschätzten dieses Instrument zugunsten des vermeintlich leichteren Weges der öffentlichen Demonstration persönlicher Freundschaft mit Putin.
Große Teile der russischen Gesellschaft sind in Bewegung, auf der Suche nach neuen Idealen, Modellen und Standards, und es wäre verhängnisvoll, sie weiter der unwidersprochenen Manipulation durch eine politische Elite in Moskau auszuliefern, die nichts als die Machtsicherung im Sinn hat. Hier kommt es darauf an, die Vorzüge des kritischen Pluralismus, der Gewaltenteilung und der Rechtsstaatlichkeit hoch zu halten. Die bilaterale Gipfeldiplomatie der EU-Staaten drückt sich nach Möglichkeit vor einer klaren Ansprache der Verstöße russischer Militärs gegen die Menschenrechte, der Manipulation von Wahlen auf allen Ebenen, des systematischen Abbaus der Pressefreiheit, der politischen Einflussnahme auf die Gerichte und einer allgegenwärtigen Korruption. Die Begründung, das vertrauliche Gespräch mit dem russischen Staatspräsidenten sei besser geeignet, Abhilfe zu schaffen als eine höfliche, aber klare Thema-tisierung offenkundiger Skandale, bleibt fadenscheinig.
Nun war es sicher immer schon naiv anzunehmen, öffentliche kritische Erklärungen westlicher Politiker könnten die sowjetische oder russische Politik unmittelbar beeinflussen. Die gemeinsame Pressekonferenz der Präsidenten Bush und Putin in Bratislava im Frühjahr 2005 zeigte jedoch eindrucksvoll, dass der Stil des öffentlich geführten Dialogs sehr wohl einen Unterschied macht, und dass es möglich ist, die Balance zwischen außenpolitischem Pragmatismus und Glaubwürdigkeit zu finden und dabei die Orientierung an den Grundlagen westlicher Demokratie zu wahren. Die Macht öffentlicher Diplomatie beschränkt sich eben nicht auf die Ebene abstrakt-pathetischer Grundwertediskussionen. Politisch ungleich wirkungsvoller sind Hinweise auf grundlegende Erfahrungen:
a. den im internationalen Vergleich bestätigten positiven Zusammenhang zwischen der Höhe ausländischer Direktinvestitionen und dem Niveau an Rechtssicherheit, Transparenz und Legitimität der Macht,
b. die Feststellung, dass hohe Devisenerlöse aus Energieexporten eine umfassende Modernisierung von Wirtschaft und Staat unter Einbeziehung der Gesellschaft nicht ersetzen können und
c. die Schlussfolgerung, dass die Opportunitätskosten eines autoritären Staatskapitalismus unverhältnismäßig hoch sind.
Diese Argumente eines „aufgeklärten Realismus“ haben in der neuen wirtschaftlichen Elite und der jungen Generation Russlands immer noch eine wichtige Zielgruppe, zumindest in jenem Teil, der Reformen nicht nur als Gelegenheit zur Bereicherung betrachtet. Sie nicht öffentlich vorzubringen oder der Moskauer Führung sogar, wie dies Berlusconi und Schröder taten, eine formale Legitimität ihrer offenkundigen Verstöße gegen internationale Standards zu bescheinigen, ist zumindest fahrlässig und in der Fixierung auf eine kurzfristige Agenda (die „strategisch“ genannt wird, nur weil die anvisierten Geschäftsabschlüsse ein hohes Volumen aufweisen) kontraproduktiv.
Es gibt keinen besseren Weg, Einfluss auf die russische Politik zu gewinnen, als die Emanzipation der russischen Gesellschaft mit dem unbeirrbaren Hinweis auf westliche Standards und das Erfolgsmodell der offenen Gesellschaft zu fördern. Die direkte Unterstützung demokratischer Aktivisten sollte nicht ausgeschlossen werden, auch um den Preis, den Zorn der Neokonservativen in Moskau zu provozieren. Allerdings muss dabei der Erfahrung Rechnung getragen werden, dass Organisationen der Zivilgesellschaft keineswegs immun sind gegen Unterwanderung durch staatliche Organe, und dass andererseits eine langfristige Alimentation durch das Ausland die Authentizität und die politischen Antriebskräfte demokratischer Bewegungen untergraben kann. Auch die Erfahrungen mit „farbigen Revolutionen“ in Georgien und der Ukraine sollten nicht überschätzt werden, denn die neuen Führer müssen ihr Stehvermögen gegenüber den Versuchungen der Macht und ihre überlegene Einsicht in die Probleme des Systemwechsels erst noch durch Stärkung der demokratischen Institutionen ihrer Länder beweisen.
Die kritische Substanz
Die Agenda der westlichen Diplomatie unterliegt eigenen Regeln. Hier geht es darum, die bewährten Instrumente des vertraulichen Dialogs wie auch der Intervention im Rahmen der OSZE und des Monitoring durch den Europarat scharf zu halten und die vereinbarten Mechanismen multilateraler Verhandlungsrunden, wie der „EU-Russland-Wegekarte“, zu aktivieren. Die Außenpolitik der EU bleibt ungeachtet der aktuellen Krise um Verfassung und Finanzierung grundsätzlich fähig zu globalem Handeln, d.h. sie kann und wird weiter Einfluss nehmen auf die Gestaltung von Standards für den internationalen Handel und die Umwelt, bis hin zum Verbot des Einsatzes von Landminen oder zur Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs. Mittel- und langfristig führt kein Weg an diesen Normativsystemen vorbei – nicht für Russland, nicht einmal für die USA. Der Status der EU als „normative Großmacht“ ist intakt, und die Grundsätze der in Brüssel formulierten Russland-Politik entsprechen diesem Selbstverständnis. Umso schwerer wiegen die Defizite bei der Institutionalisierung einer integrierten europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, denn die Neigung nationaler Regierungen zu bilateralen Alleingängen nach Moskau unterminiert die Glaubwürdigkeit der europäischen Positionen.
Allzu hohe Erwartungen verbieten sich auch mit Blick auf die G-7-Staaten: Die Unterstützung demokratischer Kräfte in Russland wird in dem Maße nicht praktikabel, wie sich „im Westen“ selbst das Vertrauen in die demokratische Substanz staatlichen Handelns auflöst. Längst haben sich Polittechnologen aller Länder – auch in den USA – in ihrer Verachtung für das Wahlvolk auf den kleinsten gemeinsamen Nenner überlegener Manipulation geeinigt. Wenn aber auch in westlichen Gesellschaften das Vertrauen in die Legitimität von Macht schwindet, wenn der politische Prozess mit bloßem Machtmanagement verwechselt wird, wenn die Bemühungen um Machterhalt nicht einmal vor einer Demontage der Gewaltenteilung zurückschrecken, dann gerät das mit viel Pathos beschworene globale Projekt, Freiheit und Demokratie zu fördern, in ernste Schwierigkeiten. Dann aber geht nicht nur Russland verloren.
Internationale Politik 9, September 2005, S. 64 - 70