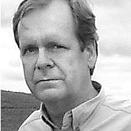Eine neue Partnerschaft
Deutschland und Afrika könnten so viel mehr gemeinsam erreichen, wenn die politische Zusammenarbeit verbessert würde. Auch um China auszustechen
Wir kamen spät und gingen früh. Kaum mehr als 30 Jahre währte die koloniale Periode in der deutschen Geschichte. Vor einem Jahrhundert, am 28. Juni 1919, wurde sie in Versailles beendet.
Für die zeitgenössische öffentliche Meinung war der Verlust der Kolonien ein Teil der „Schmach von Versailles“. Für uns heutige Deutsche ist er ein unschätzbarer Vorteil, dessen wir uns kaum bewusst sind. Unser erzwungener früher Rückzug aus Afrika hat das große Vertrauen begründet, das man uns auf dem Kontinent entgegenbringt und den ausgezeichneten Ruf, den wir dort genießen. Briten, Franzosen und Belgier, die bis in die 1960er Jahre an ihren Kolonialreichen festhielten, können da oft nicht mithalten. Wir sollten deshalb, zumindest im Blick auf Afrika, Versailles mit Genugtuung sehen, unabhängig von den verhängnisvollen Folgen, die der Friedensvertrag für Deutschlands Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg gehabt hat.
Reichskanzler Otto von Bismarck hatte sich am Wettlauf der europäischen Mächte um überseeische Besitzungen lange nicht beteiligen wollen. Seine Sorge galt stets der Konsolidierung des Reichs von 1871, dessen Grenzen er nicht für gesichert hielt. Überliefert sind skeptische Äußerungen wie diese: „Ihre Karte von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in Europa. Hier liegt Russland, hier liegt Frankreich, und wir sind in der Mitte, das ist meine Karte von Afrika.“
Europa beherrschte zu dieser Zeit die Welt. Portugal, Großbritannien und Frankreich, aber auch die Niederlande, Belgien und Spanien hatten teils schon Jahrhunderte zuvor Häfen und Stützpunkte rund um die Erde errichtet, aus denen im 19. Jahrhundert Kolonien von großer wirtschaftlicher Bedeutung wurden. Das zu spät gekommene Deutsche Reich hatte an dieser Aufteilung der Welt nicht teilgenommen und forderte erst nach der Thronbesteigung Wilhelms II. mit wachsendem Nachdruck seinen „Platz an der Sonne“. Konflikte mit den bereits etablierten Kolonialmächten wurden nach Bismarcks Abschied unausweichlich. In seinen letzten Amtsjahren hatte er sich, in der selbst gewählten Rolle als ehrlicher Makler, noch um Interessenausgleich der europäischen Mächte bemüht. 1884 lud er sie zu einer Konferenz nach Berlin ein, an deren Ende eine neue Grenzziehung für große Teile Afrikas stehen sollte. Sie hatte 80 Jahre später bei Afrikas Dekolonisierung weitgehend Bestand. Ihre Willkürlichkeit hat dem Kontinent bis heute zahlreiche blutige Konflikte beschert.
Wenig Licht, viel Schatten
In den 1880er Jahren konnte sich das Deutsche Reich quasi in letzter Minute noch zwei größere Gebiete in Südwest- und Ostafrika nehmen, dazu zwei kleinere – Kamerun und Togo – in Westafrika sowie einige kleine Besitzungen in Ostasien und Ozeanien. Kein Vergleich zu den Kolonien Großbritanniens und Frankreichs: Ein deutsches Weltreich konnte nicht zustande kommen. Die Kriegsmarine war zu schwach, um es zu sichern, und vor allem fehlte es an einem nationalen Konsens mit entsprechendem politischen Rückhalt, um ein Kolonialreich zur Priorität werden zu lassen wie bei den beiden großen Konkurrenten. Deutschland mit seiner noch jungen Nationalgeschichte blieb eine europäische Landmacht mit tief provinzieller Prägung.
In der kurzen Zeitspanne ihrer Kolonialgeschichte unterschieden sich die deutschen Händler, Ingenieure, Siedler, Beamten, Soldaten und Abenteurer in ihrem Handeln und Verhalten nicht fundamental von den Repräsentanten anderer europäischer Mächte in der Nachbarschaft. Es gab Licht und Schatten – so wird es im Übrigen bis heute in Afrika gesehen. Um 1900 bestimmte der Dualismus von Entwicklung und Ausbeutung überall die Kolonialpolitik, teils mehr, teils weniger rational organisiert. Wer in die Kolonien ging, wollte in erster Linie sein Glück machen, ohne besondere Rücksicht auf die so genannten „Eingeborenen“. Erziehung und Gesundheitsfürsorge überließ man den Missionaren, die auf ihre Weise die erste Generation moderner afrikanischer Eliten formten, die später die Dekolonisierung erkämpfen sollten.
Kulturelle Unerfahrenheit und Machtstreben, vor allem aber – zeittypisch und nicht spezifisch deutsch – Mangel an Respekt und menschlichem Einfühlungsvermögen führten zu den Tiefpunkten der deutschen Kolonialgeschichte. Aufstände der Herero 1904 im heutigen Namibia und der Maji-Maji von 1905 bis 1907 in Tanganjika wurden blutig niedergeschlagen. Tausende von Herero und Nama fielen der Grausamkeit des Kommandeurs der Schutztruppe, General von Trotha, zum Opfer.
Dies löste in Berlin ein Umdenken und einen Politikwechsel aus, der 1907, nach dem langwierigen Maji-Maji-Krieg, zur Gründung des Reichskolonialamts führte. Die Staatssekretäre Bernhard Dernburg und Wilhelm Solf setzten weniger auf Arbeitszwang, Gewalt und Erniedrigung und modernisierten die Kolonialverwaltung. Daraufhin kam es in den letzten Jahren bis zum Kriegsausbruch 1914 nicht mehr zu größeren Aufständen. Und dann war alles ganz schnell wieder vorbei.
Was ist geblieben von diesem kurzen Augenblick der Weltgeschichte? Eine Eisenbahnlinie in Tansania; die Stadtbilder von Windhuk und Swakopmund sowie etwa 20 000 Deutschnamibier, gut integriert und seit Generationen heimisch in Namibia; ein mit deutschen Mitteln restauriertes Dampfschiff, das den Tanganjikasee herauf und herunter fährt; ein paar Gebäude in Jaunde und Qingdao, damals Tsingtao genannt; Kolonialbriefmarken, die kaum noch jemand sammelt; ein paar Straßennamen im Wedding, um deren Bestand gestritten wird; Kunstwerke und leider auch menschliche Gebeine in den Depots unserer Museen, was uns heute peinlich ist und sein muss.
Die Restitutionsdebatte hat begonnen und wird wie alle Diskussionen dieser Art gewiss lange andauern. Im Zentrum deutscher Afrika-Politik kann sie aber nicht stehen – dafür sind Gegenwarts- und Zukunftsfragen viel zu wichtig, wie zum Beispiel die Herausforderung, die von China ausgeht und Afrika in neue Abhängigkeit bringt. Ist die kurze Zeit des deutschen Kolonialismus insgesamt also nur ein Nebengleis unserer bewegten Nationalgeschichte?
Die Gnade des frühen Abschieds
Vielleicht doch nicht. Deutschland ist in Versailles eine historische Chance zuteil geworden, ohne dass unsere Urgroßväter das seinerzeit so hätten sehen können. Sie mussten Afrika 40 Jahre früher verlassen als ihre damaligen Feinde und heutigen Partner in Europa.
Heute hilft uns das. Wir genießen die Gnade nicht der späten Geburt, sondern des frühen Abschieds. Die Erinnerung an Frankreich, Großbritannien, Portugal und Belgien als Kolonialmächte ist in Afrika bis heute präsent, die an Deutschland hingegen verblasst. Mehr noch, sie ist überlagert von einem ganz anderen Deutschland-Bild.
Von 1920 bis 1950 war Deutschland in Afrika unsichtbar, wenn man von Rommels Feldzug und den Madagaskar-Phantastereien der SS absieht. Danach kamen die Deutschen leise und arbeitsam zurück, als Ingenieure, Techniker und Entwicklungshelfer. Ohne postkolonialen Anspruch und mit viel Idealismus begann eine lange Periode oft sehr sinnvoller und auch nachhaltiger Unterstützung afrikanischer Entwicklungsbemühungen. Die Last der Dekolonisierung seit den späten 1950er Jahren hatten wir nicht mitzutragen, und bis 1973 gehörten wir noch nicht einmal den Vereinten Nationen an, die sie zu organisieren hatten. Unsere Rolle war gänzlich unpolitisch, dafür aber eminent praktisch. Die Konkurrenz der beiden deutschen Staaten bis 1989 war dabei oft belebend, zuweilen auch grotesk.
So haben sich im Schatten der großen Politik mehrere Generationen neuer Afrika-Deutscher gebildet. Sie bauten Brunnen, impften Kinder und bekämpften die Rinderpest. Sie brachten sauberes Wasser und erklärten, oft mit nachhaltigem Erfolg, was man tun muss, damit es nicht wieder ungenießbar wird. Die vielen afrikanischen Krisen brachten es mit sich, dass die deutschen Helfer teils im Sinne der Entwicklung des Kontinents – so wie sie in wechselnden Moden jeweils definiert wurde –, teils als Linderer menschlicher Not in Afrika arbeiteten. Sie machten im Laufe der Jahrzehnte so ziemlich alles, nur politisch war es nie.
Nun hat Afrika seit der Jahrtausendwende enorme Fortschritte gemacht, wenn auch mit einigem Vor und Zurück und nicht überall. Die Afrikanische Union hat sich politische Strukturen gegeben, die regionalen Zusammenschlüsse der Staaten haben sich zu wichtigen Begleitinstanzen ihrer Mitgliedstaaten entwickelt. Afrika ist politischer geworden, als Gesamtkontinent sichtbarer und anspruchsvoller. Die Armut ist deutlich zurückgegangen. Zugleich sind Geburtenzuwachs, Verstädterung und Migrationsdrang nach Norden keineswegs unter Kontrolle, wird der Klimawandel nur unzureichend bekämpft und dauert eine Reihe meist schon sehr alter Kriege und Konflikte an. Aber es geht langsam aufwärts auf dem Kontinent.
„Mehr für mehr“
Was bedeutet das für Deutschland? Auch wir müssen politischer werden bei unserer Haltung gegenüber Afrika, im europäischen Rahmen ebenso wie national. Bis 2015 haben wir kaum jemals politische Interessen in Afrika verfolgt. Die Bilder aus Lampedusa, Ceuta und Melilla haben uns jedoch dazu gebracht, das Mittelmeer in neuem Licht zu sehen: als mare nostrum, wie einst die Römer. Wir teilen es mit Afrika und sind auf dem Weg, ein Doppelkontinent zu werden wie Nord- und Südamerika.
Aus Brüssel und den anderen europäischen Hauptstädten wurden erstmals politische Forderungen an den Kontinent gestellt: behutsam zunächst, mit der Formel „mehr für mehr“: Kontrolliert eure Migrationsströme dort, wo sie entstehen, dann erhöhen wir die Entwicklungshilfe. Neuerdings auch mit härteren Bandagen, um Migranten wirksam abzuschrecken. Ob die Gleichung langfristig aufgeht? Man kann es heute noch nicht sagen.
Ein neuer Blick auf Afrika
Was kann es für Deutschland heißen, in Afrika politischer zu werden? Gewiss nicht, deutsch-afrikanische Gipfeltreffen einzuführen. Es gehört sich nicht, dass ein Land mit einem Kontinent spricht. Wenn China oder Japan das tun, kann man es noch damit erklären, dass sie innerhalb Asiens Solitäre sind, ohne enge Partner in einer starken Regionalinstitution. Für europäische Länder gilt das nicht.
Europäisch-afrikanische Konferenzen, auch in regionalen Formaten, sollten hingegen häufiger stattfinden, weniger als feierliche Gipfeltreffen und stattdessen stärker wirtschaftsbetont. Statt des Feilschens um Kommuniquétexte, die hinterher niemand mehr liest, sollte man sich konkrete Ziele setzen. Hier kann Deutschland konzeptionell durchaus in Führung gehen, denn Konsens etwa darüber, dass die chinesische Umarmung Afrikas dort zu plötzlicher Atemnot führen kann, lässt sich unter Europäern sicherlich leicht herstellen.
Hätten wir konkurrenzfähige Angebote für die immensen Infrastrukturaufgaben in Afrika, dann würden die chinesischen Arbeiter dort von den Straßen verschwinden und unsere zeitgemäßen Ideen von Technologietransfer und beruflicher Bildung die Oberhand gewinnen, zum nachhaltigen Nutzen Afrikas. Das kostet Geld, gewiss. Aber man kann es finden und die in Deutschland und Frankreich bereits kursierenden Ideen zu neuen Entwicklungsfinanzierungsmodellen vom Kopf auf die Füße stellen. Warum gründen wir beispielsweise keine europäisch-afrikanische Entwicklungsbank, die den neuen chinesischen Institutionen Paroli bietet?
Hundert Jahre nach Versailles wäre ein neuer geopolitisch und geoökonomisch determinierter Blick auf Afrika der beste Beitrag zu dessen weiterer Emanzipation, den Deutschland leisten könnte. Nur mit konstruktiver Einlassung auf den südlichen Teil des Doppelkontinents lässt sich der Angst vor Afrika und seinen jungen Migranten begegnen, die in vielen deutschen Köpfen spukt. Diese Angst ist irrational und blockiert das Denken in globalen Zusammenhängen. Niemand wandert unter Lebensgefahr nordwärts, wenn er zu Hause ein würdiges Leben führen kann. Damit dies so wird, muss in Afrika besser regiert und in Europa weitsichtiger geplant werden – politisch, und nicht nur entwicklungspolitisch wie bisher.
Wer in Afrika lebt, weiß, dass man dort, ein Jahrhundert nach dem Ende einer Beziehung ohne Gleichgewicht, eine konstruktive Partnerschaft unter Gleichen erwartet. Wir sollten uns jetzt in jeder Hinsicht darauf einlassen.
Dr. Albrecht Conze ist seit 2017 deutscher Botschafter in Uganda. Es ist seine dritte Station in Afrika, nach Benin (2006 bis 2008) und Simbabwe (2008 bis 2011).
Internationale Politik 3, Mai/Juni 2019, S. 82-86