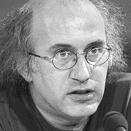Zielloses Missvergnügen
Über das Elend deutscher Politik
Der „dröhnende, pausbäckige, gedankenlose Pragmatismus der neunziger Jahre“ hat die beiden
großen Volksparteien, die SPD wie die Union, in eine tiefe Sinnkrise geführt, auch wenn das bei
der Union gegenwärtig noch nicht so sichtbar ist. Die notwendigen Reformen, die auch Verzicht
auf viele Annehmlichkeiten bedeuten, lassen sich aber, so der Göttinger Politikprofessor Franz
Walter, nur durchsetzen, wenn der Bevölkerung ein einleuchtendes und richtungweisendes Konzept
präsentiert, wenn die Politik mit Sinn erfüllt werden kann.
Hier soll über das „Elend deutscher
Politik“ geschrieben werden. So jedenfalls lautete die
provisorische Überschrift, die die Redaktion dieser
Zeitschrift dem Verfasser bei ihrer Anfrage mit auf den Weg
gab. Besonders motivierend schien das zunächst nicht. Denn
worin sollte der Reiz liegen, ein weiteres Mal in die seit
Monaten herumgereichte Krisentrompete zu blasen, abermals
über den „Patienten Deutschland“ bittere
Tränen zu vergießen, „the German
Disease“ zu beklagen, die „verkrustete
Konsensgesellschaft“ anzuprangern, den
Qualitätsverfall der „Politischen Klasse“
hämisch zu diagnostizieren. Im Grunde war man der ewigen
apokalyptischen Reiterei doch irgendwie leid.
Warum eigentlich schrieb kaum jemand, fragte man sich
vielmehr, dass die alte, nachgerade verrufene bundesdeutsche
Konsensrepublik in ihrem letzten Jahr, nämlich 1989, weit
mehr Wachstum und Arbeitsplätze, aber erheblich weniger
Erwerbslosigkeit und Inflation aufwies als das
Großbritannien von Margaret Thatcher im damals immerhin
schon zehnten Jahr der nach wie vor von den deutschen Eliten
wollüstig gepriesenen „Revolution“ jener
Eisernen Lady?1 Warum liest man kaum einmal, dass seither die
Zahl der Arbeitsplätze im Westen Deutschlands um mehr als
1,5 Millionen angestiegen ist, dass es mit der
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der
Unternehmen hier weiterhin keineswegs schlechter gestellt ist
als in Großbritannien oder auch in den USA, trotz aller
vermeintlichen Überregulationen und Etatisierungen der
deutschen Wirtschaft und Gesellschaft?2
Nun sollte die Ökonomie nicht das Thema des Verfassers
sein. Aber sind für die Politik die schrillen
Unheilsprophetien nicht ebenso verfehlt, in ihren
Negativurteilen über die Leistungen der Regierenden nicht
geradezu maßlos? Schließlich sind diejenigen
Minister, die im Jahre 2004 an der Spitze klassischer Ressorts
stehen, keineswegs schlechter als ihre Vorgänger in den,
sagen wir, fünfziger, siebziger oder neunziger Jahren. Und
auch der Kanzler selbst übertrifft an Energie, Härte,
Reaktionsschnelligkeit, winkelzügiger Schlitzohrigkeit
– alles wichtige Tugenden und Fähigkeiten für
einen Politiker ganz vorn – gewiss gleich mehrere aus der
Galerie bisheriger Regierungschefs. Und Regierungspannen sind
keineswegs eine besonders beklagenswerte Eigentümlichkeit
des gegenwärtigen Kabinetts, sie sind eine ganz
gewöhnliche, völlig unvermeidliche Konstante von
Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, mit Höhepunkten
vermutlich unter dem nur vermeintlichen „Macher“
Helmut Schmidt in seinen letzten beiden Jahren und dem
großen Patriarchen Konrad Adenauer in seinen letzten vier
Jahren, die von den Zeitzeugen gewiss als nicht weniger
quälend empfunden wurden als die handwerklichen Fehler
derzeit.3 Es ist also in der Tat alles viel weniger erstmalig,
aufregend, katastrophisch, dramatisch, wie es im mitunter
hysterischen Konzert der Medien- und Meinungseliten in diesen
Wochen und Monaten klingt.
Implosion der Volksparteien
Einerseits jedenfalls. Doch andererseits gibt es
zugegebenermaßen einige Indikatoren für veritable
Probleme im politischen System der deutschen Bundesrepublik.
Man hat diese Demokratie oft als eine Parteiendemokratie
beschrieben. Und ohne Zweifel hing die Stabilität der
Republik an der Stabilität besonders der beiden
Volksparteien. Die Stabilität der beiden Volksparteien
wiederum wurzelte in der Loyalität spezifischer Gruppen,
in der Bindekraft besonderer Weltanschauungen, die
gewissermaßen vorvolksparteilichen Ursprungs waren: bei
der CDU/CSU waren das kirchengebundene Bundesbürger mit
dezidiert christlich-bürgerlichen Einstellungen; bei der
Sozialdemokratie war das die gewerkschaftlich organisierte
Arbeiterklasse mit einem
sozialistisch-solidargemeinschaftlichen Ethos.
Doch ganz offenkundig versiegen nunmehr diese Quellen
traditionsgestifteter Integration der Volksparteien. Am
härtesten und frühesten hat der Verschleiß des
Integrationskerns bislang die Sozialdemokraten getroffen. Seit
1990 hat die Partei rund 300000 Mitglieder verloren, etwa ein
Drittel ihres damaligen Bestands.4 Bei einigen der letzten
Regionalwahlen dezimierte sich ihr Wähleranteil um mehr
als zehn Prozentpunkte, was man in dieser Bündelung allein
aus den Kinderjahren der Bundesrepublik kannte. In einigen
Bundesländern (Bayern, Sachsen) und bei den bundesweiten
Umfragen im Frühjahr 2004 erreicht die SPD im Prinzip
schon kein volksparteiliches Niveau mehr.5
Alarmierend für die Partei ist, dass ihr gerade die
klassischen Kernschichten von der Fahne gehen. 130 Jahre lang
war die industrielle Arbeiterklasse die soziale Basis und der
ideologische Fokus schlechthin für die SPD. Auch in den
übelsten Weimarer Jahren blieb dieses
industrieproletarische Fundament stabil, trug die Partei durch
alle politischen Turbulenzen und sozialen Erschütterungen.
Die SPD hatte im Sommer 1932 nicht weniger Mitglieder als im
Sommer 1928, nach vier Jahren härtester Krise also.6 Doch
jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist die Arbeiterschaft
in einem Umfang und einem Tempo auf der politischen Flucht wie
vergleichbar nur die gewerblichen Mittelschichten von 1924 und
1930. Die Volatilität der deutschen Mittelschichten hat in
den Weimarer Jahren die republikanische Mitte unterminiert. Der
Exodus der Arbeiter und Unterschichten gefährdet nun, wie
seit Monaten zu beobachten, zumindest die
Mehrheitsfähigkeit, aber mehr noch: die Stabilität
und Identität der Sozialdemokratie. In gewisser Weise
implodiert die Partei. Doch ist das nicht allein eine
innersozialdemokratische Angelegenheit. Denn nochmals: Die
jahrzehntelange Stabilität der Republik beruhte auf der
Konsolidität beider Volksparteien, auf ihrer
Fähigkeit und Überzeugungskraft zur politisch und
sozial weit ausgreifenden Integration.
Bricht der eine Stützpfeiler weg, dann halten über
kurz oder lang auch die anderen nicht mehr. Die Union
profitiert zwar derzeit demoskopisch von den Einbrüchen
der Sozialdemokraten. Doch im Grunde müsste sie sich
über den Verfall der anderen Volkspartei ernsthaft Sorgen
machen. Aber auch in der CDU/CSU werden in den nächsten
Jahren die Traditionskerne mächtig bröckeln, die
Stammwählerschaften massiv zerbröseln. Denn der
Anteil der kirchengebundenen oder kirchennahen Menschen in
Deutschland ist in der Generationenfolge zuletzt erdrutschartig
abgesunken. Bei den bundesrepublikanischen Katholiken, die das
30. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, ordnen sich
nur noch 18% dem Lager der mindestens mittelbar
Kirchenverbundenen zu. Bislang aber liegt in der
Gesamtbevölkerung der Durchschnitt bei ca. 55% – was
ziemlich exakt dem Wähleranteil der Christlichen Union in
diesem Teil des Wahlvolks entspricht.7 Die praktizierte
Kirchlichkeit war über Jahrzehnte der alles entscheidende
Stoff für die Loyalität zur Union; dieser Stoff wird
bis zum Ende des Jahrzehnts kursorisch zur Neige gehen.
Insofern könnte die sozialdemokratische Implosion bald
eine christdemokratische Parallele finden.
Unheilsszenarien
Nun wirkt ein solches Unheilsszenarium aus der Perspektive
dieser Tage weit übertrieben, geradezu neben der
Realität liegend. Die Union steht schließlich in den
aktuellen Umfragen eher vor der absoluten Mehrheit der
Regierungsmacht als vor dem Abgrund einer in sich
zusammenfallenden Partei. Doch eine kraftvolle, kohärente
Partei, die zielstrebig eine neue Ära und Agenda
bürgerlicher Reformen anstrebt und dabei auf der Welle
aktiver und mehrheitlicher Unterstützung der
bundesdeutschen Bevölkerung reitet, ist die CDU nicht. Sie
reüssiert augenblicklich vielmehr als ein hochfragiles
Sammelbündnis der Frustrierten aller Lager. Es sind die
aus ganz verschiedenen Motiven gespeiste Wut und Verbitterung
über Rot-Grün, die die Werte für die Union in
die Höhe treiben, nicht der entschlossene Impetus für
eine radikale Reform der altsozialstaatlichen Institutionen und
Regelwerke.
Auf der einen Seite des christdemokratischen Sammel- und
Frustrationsbündnisses stehen kleine, aber ökonomisch
bedeutsame, artikulationsmächtige Gruppen des gewerblichen
Bürgertums, denen Schröders Reformen nicht schnell
genug gehen, nicht tief genug ansetzen, nicht rigide genug in
ihrer Reichweite und Begründung sind. Ein großer
Teil der CDU-Führung würde sich diese politische
Interpretation wohl zu eigen machen.
Aber so recht traut er sich dann doch nicht. Denn in der
neuen Wählerschaft der Christlichen Union überwiegt
eine andere Mentalität und Erwartungshaltung. Die Union
ist in den letzten Jahren, fast flächendeckend von Nord
bis Süd, zur Mehrheitspartei der Arbeiter und auch der
(formal) Ungebildeten geworden, also von vielen Verlierern und
Verlorenen des ökonomischen Wandels. Dieses
Wählersegment verspricht sich von der CDU Schutz und
Sicherung – wie es ihm von der CDU in den alten Zeiten
von Adenauer bis Helmut Kohl stets auch instinktsicher
zugesichert wurde.8 Man erinnert sich an den typisch
christdemokratischen Slogan: „Keine Experimente“.
Auch ist die Mehrheit der christdemokratischen Wähler
älter als 60 Jahre, wie es sich zuletzt in Hamburg bei den
Bürgerschaftswahlen zeigte, die insofern für die CDU
keineswegs ein Zeichen juveniler oder neumittiger metropoler
Zustimmung bedeuteten.9
Insgesamt ist das Vertrauen in die Kompetenz der Union
bemerkenswert dünn. Ökonomisch und gouvernemental
traut ihr eine klare Zweidrittelmehrheit der Deutschen nicht
mehr zu als der gegenwärtigen Regierung. Die
christdemokratischen Vorschläge zur Gesundheitsreform
werden von drei Vierteln der Bundesbürger schroff
abgelehnt. In der Rentenpolitik ist es nicht anders.10 Und
selbst die von allen ökonomischen Eliten besonders
angefeindete Paradeforderung der SPD-Linken nach einer
Wiedereinführung der Vermögenssteuer stößt
auf eine mehrheitliche Zustimmung – nicht nur bei den
Bürgern insgesamt, sondern auch innerhalb der
Wählerschaft der Christlich-Demokratischen Union
selbst.11
Mit der Union als Regierungspartei wird die Republik nicht
den Aufbruch in eine wirtschaftsliberale Radikalreform erleben.
Andernfalls würde die Union unmittelbar ihren Charakter
als Volkspartei verlieren (wofür im Übrigen die
rigoroser gewordenen wirtschaftlichen Eliten seit den neunziger
Jahren kaum mehr Sensibilität und Blick haben).
Entscheidend aber ist die Ziel- und Richtungslosigkeit der
christdemokratischen Oppositionssammlung. Parteieliten und
Wähler(-mehrheit) weichen weit voneinander ab, was die
Intentionen der Politik angeht. Doch sie eint der Antieffekt
gegen die Regierung.
Man kannte das schon, aus dem anderen Lager, 1998, als die
Wahl von Rot-Grün im Grunde ebenfalls seismographisch
blass blieb, ebenfalls kein scharfer Ausdruck einer pointierten
Neuausrichtung war. Diese Unschärfe des Machtwechsels
begründete dann die erratischen Pendelausschläge
seither, die vielen, oft unvermittelten, unerklärten
Policywechsel, aber eben auch das fragmentierte,
unstrukturierte und ziellose Unbehagen daran. Die Kritik an der
Regierung verliert an sozialmoralischer und normativer
Voraussetzung, Substanz und Perspektive, aber auch die
alternativen Erwartungen an die Opposition laufen auseinander,
sind ohne innere Ordnung und Kohärenz.
Sinnverlust der Politik
Wahrscheinlich liegt hier der Kern der Krise von Politik und
Parteien in Deutschland (und etlichen anderen Demokratien
ebenso): die Sicherheit von Sinn und Ziel, die den politischen
Alternativen früher kontrastscharf zugrunde lag, ist
verloren gegangen. Doch Sinn ist neben dem Drang nach Macht der
primäre Treibstoff für den politischen Einsatz. Sinn
ist die elementare Ressource für Engagement, Anstrengung,
Leistung, Altruismus, Leidensfähigkeit, Solidarität,
Ehrgeiz, Kreativität. Das alles wissen wir
hinlänglich aus der Religionsgeschichte, der Philosophie,
der modernen psychologischen Forschung.12 Die klassischen
Parteien – gerade die sozialdemokratischen und
christlichen Parteifamilien – haben es ebenfalls, nahezu
naturwüchsig, gewusst und daher rund 150 Jahre alle
Zäsuren der Politik- und Gesellschaftsgeschichte
unbeschadet überstanden. Denn sie hatten den Mörtel
des die Gegenwart weit transzendentierenden Sinnes, der aus
Individuen überhaupt erst handlungsfähige und
verbindlich organisierte Assoziationen machte, die auch dann
noch beieinander blieben, als die unmittelbaren (materiellen)
Interessen schon realisiert waren.
Doch damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Die großen
Sinnperspektiven von Sozialdemokraten und Christdemokraten
(Sozialismus und Wirtschaftsdemokratie hier; Heimat, Nation und
Christentum dort) haben sich entweder erledigt oder sind
trivialisiert, gar diskreditiert. Und neuer Sinn, der die
Mitglieder wieder beflügelt, steht nicht bereit. Dazu
fehlen die großen homogenen Soziallagen, aus denen
holistische Weltanschauungen überhaupt nur entstehen
können. Dazu fehlt es unter dem Diktat flüchtiger
sozialer Beziehungen auch an „Gleichheit und
Kontinuität in der Zeit“ (Erik Erikson), die
Identität und Sinn schaffen.13 Und der Sinnverlust ist
gewiss ebenfalls Folge jenes dröhnenden,
pausbäckigen, gedankenlosen Pragmatismus der neunziger
Jahre, der von großen Utopien wohl zu Recht nichts wissen
wollte, dabei aber, gewissermaßen in einem großen
Ausverkauf, alles programmatische Denken, jeden konzeptionellen
Entwurf gleich mit entsorgte.
Der sinnentleerte Pragmatismus hat der Politik und den
Parteien die normativen Fluchtpunkte genommen. Nicht zuletzt
deshalb ist die „Reformpolitik“ beider
Volksparteien so unpopulär, so gering an
Unterstützung. Denn die Parteien können nicht
angeben, wohin die Reise gehen soll, wo sich das „gelobte
Land“ am Ende der Wüste aus Sparsamkeit,
Einschränkungen, Verzicht und Abbau befindet, wie es dort
aussieht oder auch nur aussehen sollte. Doch gibt es in der
Geschichte wenig Beispiele, dass ohne Positivbotschaften und
faszinierende Leitideen, ohne ein Credo des Besseren
reformerische Energien und kreative Kräfte freigesetzt
worden wären.14 Aber selbst unter den Protagonisten der
Agenda 2010 ist unklar, ob diese Politik mit dem Ziel einer
Sanierung und Stärkung des Sozialstaats umgesetzt wurde;
oder ob der Sozialstaat reduziert, eingeschränkt,
zurückgeschnitten werden soll, weil er Freiheit behindert,
Eigenverantwortung erstickt, Investitionsneigungen lähmt,
wie es bei den „Reformern“ oft heißt.
Innerhalb der SPD-Elite werden, zumindest in
Vieraugengesprächen, beide Ansichten kolportiert. Aber
eben diese Sinnindifferenz, diese Zielunschärfe hat die
sozialdemokratischen Mitglieder deaktiviert, die
Multiplikatoren verstummen lassen, die Parteiorganisation
ermattet und erschöpft. Der Sinnverlust ist der
Ausgangspunkt für die Implosion der Parteien.
Defizite und Probleme
Die Volksparteien hatten nicht nur ihren früheren
Sinnstoff verloren, sondern auch – vielleicht gerade
dadurch – viel an kraftvoller Repräsentation
verschiedener Lebensbereiche. Aber mit diesem Verlust an
Repräsentationsfähigkeit stellen sie sich, stellen
sie jedenfalls ihren Anspruch, Volksparteien zu sein, zunehmend
in Frage. In ihren Glanzzeiten aggregierten und verklammerten
die Volksparteien ganz verschiedene Generationen,
Lebenserfahrungen, Biografien, auch Soziallagen und
Wertebegründungen. Sie holten exponierte Vertreter der
beiden großen christlichen Kirchen in ihre
Führungsmannschaften, ebenso hervorragende Gewerkschaftler
und erfolgreiche Unternehmer; es gab einige glänzende
Intellektuelle, mehrere Vordenker neuer außenpolitischer
Wege. Viel ist davon nicht übrig geblieben; der soziale
und kulturelle Zuschnitt der Volksparteien hat sich enorm
verengt und vereinseitigt. Der Typus des Parteiintellektuellen
ist rar geworden. Profilierte Sozialpolitiker, aber auch
Ökonomen existieren, hier wie dort, kaum noch.
Außenpolitische Strategen und Konzeptionalisten, die sich
früher in übergroßer Zahl in der Politik
tummelten, lassen sich in den beiden Volksparteien nur noch
unzureichend auftreiben.
Die Parteien sind nicht nur an Profil und Köpfen
ärmer geworden, sondern auch an Strömungen und
Flügeln, die früher kraftvoll und vital die
Einstellungen und Lebensformen unterschiedlicher
gesellschaftlicher Lebensbereiche in die Arena der Politik
hineinvermittelten. Der Niedergang innerparteilicher
Strömungen hat allerdings auch etwas mit dem Siegeszug der
modernen Mediengesellschaft zu tun, die einen
neoautoritären, planierenden Zug in die Politik gebracht
hat. Denn Parteien fürchten die dramatisierende
Schlagzeile im Gefolge von Flügelstreitigkeiten, als
Reaktion auf ernste und lange innerparteiliche Kontroversen.
Eine Partei, die heftig disputiert, gilt in der
Mediengesellschaft als heillos zerstritten, dadurch als
regierungs- und politikunfähig. Also hegen Parteien den
Streit ein, fesseln Richtungen und Strömungen und
reduzieren somit gesellschaftliche Realität.
Überdies beschädigen sie dadurch wohl auch die
Sozialisation des Führungsnachwuchses. Die großen
politischen Anführer kamen oft genug aus dem Chaos, aus
der unerbittlichen Rivalität, dem ätzenden
Säurebad von Kontroversen, Intrigen und
Auseinandersetzungen. Die Intrige mag in den Volksparteien
übrig geblieben sein, die scharfen Diskussionen, der
ambitiöse Streit um Themen und Positionen indessen hat an
Bedeutung erheblich verloren. Gehärteter
Führungsnachwuchs, der sich irgendwann im brutalen
Haifischbecken der großen Politik behaupten muss, geht
aus solchen stillgelegten Parteien nicht hervor.15 Hinzu kommt:
Die Kraftnaturen einer Generation zieht es nur dann in die
Parteien, wenn Politik als Hebel, als archimedischer Punkt
für Einfluss und Veränderungen gilt. In diesem Ruf
stand die Politik noch bis in die achtziger Jahre. Im Jahrzehnt
danach aber überwogen die Enttäuschungen über
die mittlerweile frühen Grenzen der Politik, stattdessen
dominierten nun die hohen Erwartungen an die Möglichkeiten
einer neuen Ökonomie. Die Politik verlor also an Macht und
Potenz, infolgedessen an ehrgeizigen
vorwärtsdrängenden Begabungen. Auch das hat die
Parteien weiter geschwächt.
Fragmentierung der Macht
Politische Kommentatoren lamentieren in gefälligen
Statements gerne über die Machtfülle und
Machtverliebtheit der Politik. Doch leidet Deutschland
keineswegs an einem Übermaß an politischer Macht,
sondern im Gegenteil an einem Defizit politischer Handlungs-,
Gestaltungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten. Es ist der
schleichende Machtverlust der Politik während der letzten
zehn bis zwanzig Jahre, der die politische Klasse
allmählich ausgedörrt, die Parteien entleert hat.
Nochmals: Parteien brauchen, um kräftig, zielstrebig,
massenhaft in die Kampagne gehen zu können, scharf
geschnittene Konzepte, deutlich abgegrenzte Alternativen, weit
ausgeworfene Orientierungen – und den festen Glauben,
dies dann mit den Hebeln der Macht auch umsetzen zu
können. All das macht politische Formationen kohäsiv,
selbstbewusst und vital. Und in Wahlkampfzeiten simulieren
Parteien auch gleichsam, als würden sie über
dergleichen noch verfügen.
Doch nach dem Wahltag ist es schnell damit vorbei. Denn
für das politische System Deutschlands sind
kontrastscharfe politische Entwürfe und Gegenentwürfe
geradezu kontraproduktiv. Als Regierungspartei in einer kleinen
Koalition würde man damit allein Stagnation, ein
„rien ne va plus“ auslösen. Denn die eine
große Partei braucht in aller Regel die andere
große Partei. In keinem anderen Land der Welt ist das
machtpolitische Instrumentarium für eine Zentralregierung
so begrenzt wie hier zu Lande.16 Es wimmelt
bekanntermaßen von institutionell begünstigten
Vetomächten, die sich seit der Europäisierung der
politischen Entscheidungsprozesse zudem noch weiter vermehrt
haben.17 Bund und Länder sind überdies eng
verflochten. Und so braucht die Bundestagsmehrheit beinahe zu
allen entscheidenden Gesetzen die Mitarbeit und Zustimmung der
Bundesratsmehrheit. Die Mehrheiten in den beiden
Gesetzgebungskammern sind aber seit den frühen siebziger
Jahren überwiegend nicht mehr identisch. Also müssen
die Bundesregierung und die große Oppositionspartei
– die strukturell in Deutschland in einem Maße
exekutiv eingebunden ist wie in keinem anderen politischen
System und das nicht nur über den Bundesrat, sondern auch
durch ihren Einfluss in weiteren öffentlichen
Einrichtungen und halböffentlichen korporatistischen
Strukturen – kooperieren. Versucht Regierungspolitik,
etwas Anderes auf den Weg zu bringen, riskiert sie die
Konfrontation, dann landet sie in aller Regel in der Blockade.
Ordnungspolitik per Konfrontation bringt, so wie Deutschland
verfasst ist, nicht den erwünschten Befreiungsschlag. Im
Gegenteil: Eine Politik des Konflikts aus der Regierung heraus
verstärkt noch die Paralyse, die depressive Lage des
Nichts-geht-mehr.
Die großen Parteien dürfen also gar nicht mit zu
scharf geschnittenen, in sich kohärenten politischen
Programmen und Strategien aufeinanderstoßen, da es die
systemstrukturell verlangte Kooperation gefährden
würde. Eigentlich gibt es sogar den Imperativ zur
großen Koalition, die aber gerade bei den Meinungseliten
nicht wohlgelitten ist. So finden sich dann die Parteien oft
lediglich oder bestenfalls zu einer Art Waffenstillstand
zusammen. Doch „Waffenstillstände sind keine Zeiten
produktiver, ja kühner Gemeinsamkeiten“.18 Die
Fragmentierung von Macht führt in Deutschland
infolgedessen häufig zu einer Begrenzung der Politik, wenn
es gut geht: zu einem inkohärenten Kompromiss auf kleinem
Nenner.
Falsche politische Maßstäbe
Institutionell also ist die deutsche Politik für den
großen konzisen Wurf, für den wuchtigen
Befreiungsschlag, die generalstabsmäßig verfasste
Strategie, auch für die professionell stringente Umsetzung
schlecht gerüstet. Doch erwarten die meisten Menschen eben
all das von Politik – und sind über die
Realität dann chronisch enttäuscht. Das Bild von
Politik, das in der deutschen Gesellschaft vorherrscht, hat mit
der Wirklichkeit und den Möglichkeiten deutscher Politik
wenig zu tun. Die Vorstellung von Politik ist auch in
Deutschland „westminsterisch“ gefärbt.19 Denn
schon in der Schule erklären ganze Tausendschaften von
Sozialkundelehrern den Schülern die Demokratie am Beispiel
des britischen Westminster-Modells. Dort gibt es das
Mehrheitswahlrecht; da ist die eine in Wahlen erfolgreiche
Partei, die an der Spitze des Zentralstaats dann ungestört
durch lästige Koalitionszwänge und föderale
Beschränkungen über die gesamte Legislaturperiode
hinweg die Möglichkeit besitzt, ihr politisches Programm
konsistent zu verwirklichen und die Gesellschaft tief zu
durchdringen. So konnten Thatcher und Tony Blair agieren; so
aber war es für Schröder oder auch Kohl nicht
möglich; und so wird es für Edmund Stoiber oder
Angela Merkel ebenfalls nicht gehen – und das schafft
Verdrossenheit.
Die Mediengesellschaft füttert diese Verdrossenheit
noch. Die moderne Mediengesellschaft kreiert und festigt ein
Bild von Politik, dass nicht einmal
„westminsterisch“ ist, sondern schlicht vormodern,
ja unaufgeklärt. In den mediengesellschaftlichen Bildern
gibt es stets allein die eine Hauptstadt, die eine
Regierungsmacht, den einen Regierungschef. Auf diesen einen
Punkt konzentrieren sich alle politischen Kommentare und
Erwartungen wie zur Zeit nicht weiter differenzierter
Gesellschaften. Der Staat ist in dieser Perspektive immer noch
Zentrum und Spitze der Gesellschaft, nicht aber – was die
Realität weit mehr trifft – Manager und Koordinator
von Interdependenzen hochkomplexer, netzwerkartig verflochtener
oder auch unvermittelt koexistierender Subsysteme.
Die Vorstellung von Staat und Regierung als den zentral
regelnden, steuernden und prägenden Leitinstanzen der
Gesellschaft dominiert den politischen Alltagsdiskurs in
Deutschland. Gewiss ist dies die Erwartung der Menschen an
Staat, Regierung und Politik seit langen Zeiten. Im Prozess der
Modernisierung mit ihrem rasch wachsenden Problemhaushalt hat
sich diese Erwartung an den Staat als zügig handelnden und
kohärent steuernden Problemlöser noch weiter
erhöht. Die Krux allerdings ist, dass im Zuge der
gesellschaftlichen Ausdifferenzierung der Steuerungsbedarf
moderner Gesellschaften zwar erheblich angewachsen ist, die
Steuerungskapazitäten des modernen Staates aber im
gleichen Umfang abgenommen haben. Man erinnert sich an den
alten Staat der Vormoderne und verlangt, was der moderne Staat
gar nicht mehr bieten und leisten kann – besonders nicht
in Deutschland.20
Und doch bildet in Deutschland der handlungssouveräne
und handlungsautonome Zentralstaat den Maßstab des
politischen Kommentars. Zugleich aber denkt keine
einflussreiche Kraft in der deutschen Republik ernsthaft daran,
die institutionellen Voraussetzungen dafür herzustellen.
Niemand tritt in Deutschland für die Abschaffung der
vielen Regionalwahlen ein, für die Liquidierung des
Föderalismus, für die Beseitigung oder auch nur die
Reform des Bundesverfassungsgerichts und der autonomen
Notenbank. Oder gar für den Austritt aus dem
Gremiengeflecht der Europäischen Union. Für eine
solche, fraglos absurde Systemtransformation gibt es nirgendwo
einen gesellschaftlichen oder politischen Motor. Das aber macht
die Fundamentalkritik in Deutschland an der Kooperations- und
Konsenspolitik, an der unvermeidlich langwierigen
Verhandlungsdemokratie so richtungs- und wirkungslos. Alle
haben sich stillschweigend auf die Voraussetzungen der
föderalen Verhandlungs- und Konkordanzdemokratie
eingestellt, weil ihre unzweifelhaften Stabilitätsvorteile
höchst angenehm sind, aber alle tun rhetorisch trotzdem
so, als wünschten sie eigentlich die zentralstaatlich
orientierte Wettbewerbsdemokratie, um kraftvolle Innovationen
und Reformen zustande zu bringen.
Doch wäre es unter scharfen wettbewerbsdemokratischen
Bedingungen – die im Übrigen bei hochkomplexen
gesellschaftlichen Problemen wie die der Gesundheitspolitik
bislang auch keine besseren oder schnelleren Lösungen
hervorgebracht haben – dann vorbei mit der kommoden
Stabilität der politischen Kultur.21 Es wäre vorbei
mit Konsens, sozialem Frieden, Integration und Ausgleich, was
in Wahrheit die Deutschen doch so über alles
schätzen. Minderheiten jedenfalls haben in
zentralistischen Wettbewerbsdemokratien nichts zu lachen; sie
werden politisch chronisch vernachlässigt und
benachteiligt, ja untergebuttert. Und oft genug werden in
harten Wettbewerbsdemokratien mit starker Zentralmacht eben
mangels geduldiger Kooperation und austarierendem Konsens die
Gesetze überstürzt und schlampig im wilden
Parforceritt durch die Parlamente gepeitscht. Solcherlei
Fundamentalreformen – und warum sollten Reformen per se
gut und richtig sein? – stiften am Ende mehr Schaden als
Nutzen und sind schließlich nur noch schwer zu
korrigieren, meist allein nach empörten öffentlichen
Massenprotesten, oft gar militant geführten Streiks.
Nichts davon wollen die vorsichtigen und ängstlichen
Deutschen natürlich ernsthaft. Und doch ist die
zentralstaatliche Wettbewerbsdemokratie Kriterium und Parameter
des politischen Diskurses in Deutschland, am Stammtisch so gut
wie in den Zeitungsredaktionen. Politik wird hier wie dort an
Kriterien gemessen, die sie in Deutschland nicht erfüllen
kann und vermutlich nicht einmal soll. So werden auch
künftig die Schlauberger der Republik weiter ganz
folgenlos schimpfen und nörgeln – und laut nach den
großen Reformen schreiben, die sie im tiefsten Innern
doch so furchtbar fürchten. Dem wütenden Lamento
fehlen demzufolge Maß und Ziel. Zurück kann nur die
folgenlose Depression bleiben.
Ambivalente Mentalitäten
Vielleicht ist das überhaupt der Kern der deutschen
Malaise: die Ziellosigkeit des kollektiven Missvergnügens.
Der Unzufriedenheit fehlen Struktur, Plan und politischer
Realismus. Ein ganzes Volk ist übel gelaunt, weiß
aber nicht recht, was es eigentlich wirklich will, um aus der
Tristesse der Seelendämmerung herauszukommen. Der
Souverän der deutschen Republik steckt voller
Ambivalenzen. Seit Jahren bekundet eine Mehrheit der
Bürger die grundsätzliche Zustimmung zu einer Politik
der Reformen. Dem Gros der Bundesdeutschen geht, wird es ganz
grundsätzlich befragt, sogar die Agenda 2010 der
rot-grünen Bundesregierung nicht weit genug.22 Nun ist
nicht ganz auszuschließen, dass die Mehrheit der
Deutschen eine ganz andere Definition von „Reform“
im Kopf trägt als all die Professoren der
Betriebswirtschaftslehre, Journalisten, Unternehmensberater,
Altbundespräsidenten. Interessanterweise haben dies die
Meinungsforschungsinstitute bislang nicht einmal erkundet.
Zumindest lehnt die Mehrheit der Deutschen, die sich
grundsätzlich für Reformen ausspricht, nahezu alle
präzisen Reformvorschläge und Reformgesetze der
Regierungskoalition und der Opposition ab – und das mit
Aplomb.23 Die Reform des Gesundheitswesens, ob nun nach
rot-grünen oder schwarz-gelben Vorstellungen, wird von
rund 70 Prozent der Bevölkerung wütend negiert.
Renate Köcher vom Allensbacher Meinungsforschungsinstitut
bezeichnet den Lieblingsbegriff sämtlicher
„Reformer“, nämlich
„Selbstbeteiligung“, als ressentimentbesetztes
Reizwort für die Menschen in Deutschland.24 Die
Unterstützungsquote für manche Reformen im
Gesundheitswesen, etwa die Streichung des Zahnersatzes aus dem
Leistungskatalog der Krankenversicherungen, liegt nur knapp
oberhalb der parlamentarisch sonst so heiklen
Fünf-Prozent-Hürde.
Ähnlich sieht es mit der Resonanz zu einem weiteren,
von Reformideologen gern lancierten Vorschlag aus: der
Erhöhung des Renteneintrittsalters. Für
Chefredakteure, Universitätsprofessoren, Spitzenpolitiker,
Bankenchefs, die allesamt in kreativen, einflussreichen,
interessanten Jobs arbeiten, mag es reizvoll sein, noch ein
paar Jährchen länger zu arbeiten und dadurch den
sonst drohenden Verlust ihrer Führungsposition ein wenig
aufschieben zu können; der Rest aber – rund 90% der
Bevölkerung – macht in Umfragen
unmissverständlich klar, dass er keinen Tag länger
als nötig im Büro oder in den Werkhallen auszuhalten
gedenkt. Auch hier ist es bemerkenswert, wie wenig im
öffentlichen (Reform-)Diskurs dieser eklatante Abstand
vieler Menschen zur offensichtlich als qualvoll empfunden
täglichen Arbeitswelt eine Rolle spielt. Hingegen bekommt
die SPD-Linke, die es als handlungsfähige Struktur schon
gar nicht mehr richtig gibt, Zustimmungswerte wie noch nie
zuvor in ihrer Geschichte. Etwa zwei Drittel der Deutschen
unterstützen diejenigen Parlamentarier und Politiker der
Linken innerhalb der SPD, die die Agenda 2010 wieder
korrigieren wollen.25
Die Kluft zwischen den ökonomisch-politischen Eliten
auf der einen und einer großen Mehrheit der
Bevölkerung auf der anderen Seite könnte
größer kaum sein. Die Reformagenden im oberen
Zehntel der Republik stoßen nun schon seit Jahren auf
zähen, kaum geschrumpften Widerstand. Aber diese
Obstruktion bleibt ebenfalls ohne Ziel, ohne
Repräsentation, ohne Struktur. Es gibt in Deutschland eine
verbreitete, tief verwurzelte wohlfahrtsstaatliche
Mentalität, die sich der neoliberalen Deutungshegemonie
stur verweigert, aber es gibt kein selbstbewusst
sozialetatistisches Politikprojekt, keine wohlfahrtsstaatliche
Parteienalternative, die aus dieser Mentalität
realistische Politik zu machen im Stande wäre.
Unfähig zur Alternative
Aber selbst diese Mentalität ist ambivalent, ja
antagonistisch. Und wieder sind wir beim Kern der deutschen
Malaise, der Richtungslosigkeit und den
Widersprüchlichkeiten. Natürlich wäre eine
moderne, robuste Wohlfahrtsstaatlichkeit als Alternative zur
Agendapolitik der Regierung, erst recht zu
angelsächsischen Modellen auch in Deutschland denkbar. Die
Räume dafür haben sich unter den transnationalen
Bedingungen der Ökonomie und Politik gewiss verkleinert,
aber keinesfalls gänzlich verschlossen. Beispiele für
reformierte, aber intakte, zielbewusste Wohlfahrtsstaaten sind
die skandinavischen Länder mit beträchtlichen
Erfolgen auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssektor und vor allem
in der Familienpolitik. In der Summe jedenfalls hat sich das
nordische Wohlfahrtsmodell den angelsächsischen Projekten
signifikant überlegen gezeigt, erst recht dem deutschen
Weg, der gerade im Bereich Inklusion, Qualifikation und
Demographie erkennbar nicht weiterführt.26
Nun verlangt das skandinavische Sozialmodell allerdings nach
umfangreichen Transfers, nach einer hohen Staats- und
Sozialquote – daher auch nach erklecklichen
Steuereinkünften. Auch ein deutscher Wohlfahrtsstaat
wäre künftig allein durch massive Erhöhungen der
Steuerquote zu finanzieren. Im Gegenzug könnte man dann
allerdings die investitionshemmenden Beitragssätze in den
Sozialversicherungssystemen reduzieren. Spielraum für
Steuererhöhungen wären durchaus vorhanden, denn im
internationalen Vergleich ist Deutschland ohne Zweifel ein
Niedrigsteuerland. Doch im politischen Diskurs der Republik
gibt es für eine solche wohlfahrtsstaatliche und
steuerpolitische Wende, die in der Tat abrupt vom deutschen
Sozialversicherungspfad abweicht, wohl keine ernsthafte Chance.
Auch die Mehrheit der im Prinzip wohlfahrtlich gesinnten
Bürger hat für Steuern und daraus finanzierte
aufwändige staatliche Transfers keine Sympathien. Der
einzige Reformvorschlag der Koalitions- oder
Oppositionsreformer, der in den letzten Jahren wirklich
populär war, zielte schließlich auf steuerliche
Entlastung. Hierfür fand sich die Unterstützung von
65% der Bevölkerung. Doch gerade das macht die
Mehrheitsmentalität in Deutschland politisch richtungs-
und ziellos. Diese Mentalität sträubt und sperrt sich
zwar hartnäckig und obstinat gegen die meisten auf
Deregulierung und individuelle Eigenverantwortung abzielenden
Reformen der deutschen Politik. Aber diese
Mehrheitsmentalität findet keinen politisch konstruktiven
Sinn von sich selbst; sie bündelt, organisiert und
formiert sich nicht zu einer politisch schlagkräftigen
Alternative; sie verharrt vielmehr in Ambivalenzen und
Aporien.
Und so steht die Bundesrepublik in einem tief greifenden
Dilemma. In Skandinavien gibt es in der Bevölkerung eine
hohe Sozialstaatserwartung, aber auch eine eben so hohe
Abgabebereitschaft zur Sozialstaatsfinanzierung; das geht
ersichtlich gut zusammen. In den angelsächsischen
Ländern dagegen existiert bei den meisten Menschen eine
vergleichsweise geringe Sozialstaatsneigung, aber auch eine
niedrige Abgabementalität; das läuft ebenfalls
trefflich synchron. Die Deutschen indessen haben sich in einer
verhängnisvollen Mitte angesiedelt: sie haben auf der
einen Seite außerordentlich hohe Ansprüche an den
Sozialstaat und seine Leistungsfähigkeit, besitzen aber
auf der anderen Seite eine denkbar unterentwickelte Neigung,
dafür Zuwendung über Steuern und Abgaben zu
leisten.27
Eben das funktioniert nun begreiflicherweise überhaupt
nicht. 1997/98 wurde die CDU dafür abgestraft, dass sie
die sozialstaatlichen Standards reduzierte; und die SPD
triumphierte damals. Seit Anfang 2003 sank die SPD in ein
tiefes Umfrageloch, weil sie ihrerseits an den
sozialstaatlichen Bestand ging, nachdem ihre zwischenzeitlichen
Steuererhöhungsvorhaben das Volk und das ganze
Deutungsestablishment der Republik in helle Wut versetzt und
auf die Barrikaden getrieben hatten. Davon profitierte diesmal
die CDU. Das mag für die Union auch zum nächsten
Regierungswechsel reichen. Dann aber dürfte sich das
leidige Spielchen lediglich mit erneut verkehrten Rollen weiter
fortsetzen. Die Regierungen können die sozialen Standards
reduzieren oder sie müssen sich um zusätzliche,
anders organisierte kollektive Finanzierungsstrukturen
kümmern. Beides aber wird vom deutschen Wahlvolk derzeit
gnadenlos negativ sanktioniert.
Exakt darin liegt die Ziellosigkeit der deutschen Politik.
Es ist der Sinnverlust dieser Republik, die Richtungslosigkeit
der Politik und Gesellschaft insgesamt. Das ist es, was das
Land so missgelaunt macht, so nölig, so folgenlos
verdrossen, weil es nicht weiß, wohin es geht und weil es
über Alternativen ernsthaft nicht einmal nachdenkt.
Anmerkungen
1Vgl. Klaus von Dohnanyi, Wo steht Deutschland nach der
Wahl?, in: Zehntes Gesellschaftspolitisches Forum der
Banken. Nach der Wahl: Deutschland im Aufbruch?, o.O. o.J.,
S. 9 ff.
2Vgl. das Interview mit Peter Bofinger, in: Berliner
Zeitung, 3.2.2004; vgl. auch Thomas Fricke,
Reformkonzentrat für Deutschland, in: Financial Times
Deutschland, 5.3.2004.
3Vgl. Franz Walter/Tobias Dürr, Die Heimatlosigkeit
der Macht. Wie die Politik in Deutschland ihren Boden
verlor, Berlin 2000, S. 8 ff.
4Vgl. Die SPD verlor seit 1990 jedes dritte Mitglied,
in: Rheinische Post, 20.2.2004.
5Vgl. <http://www.wahlrecht.de/umfragen> (Stand
30.3.2004).
6Vgl. Walter, Die SPD. Vom Proletariat zur Neuen Mitte,
Berlin 2002, S. 77 ff.
7Vgl. Vertrauen der Katholiken in ihre Kirche schwindet,
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 21.2.2003.
8Vgl. hierzu Frank Bösch, Macht und Machtverlust.
Die Geschichte der CDU, Stuttgart-München 2002, S. 191
ff. Pointiert hat den christdemokratischen Antireformismus
Helmut Kohl selbst in seiner Polemik gegen die
Reformära der frühen siebziger Jahre auf den
Begriff gebracht: „Der Bürger hat ein Recht
darauf, nicht ständig politisch gefordert, sondern
auch in Ruhe gelassen zu werden, ungestört seinem
Leben nachgehen zu können, sich der Ergebnisse seiner
Leistungen zu erfreuen.“ Vgl. Kohl, Außerhalb
der Reformpolitik blieb nichts mehr, in: FAZ, 2.3.2004.
9Vgl. Richard Hilmer, Die Alten haben die Union zum
Sieger gekürt, in: Stuttgarter Zeitung, 2.3.2004;
Matthias Krupa, Senioren für Ole, in: Die Zeit,
4.3.2004.
10Vgl. SPD erstmals unter der 30-Prozent-Marke, in:
Süddeutsche Zeitung (SZ), 25./26.10.2003.
11Vgl. das Ergebnis des Politbarometers, in: SZ,
7.6.2003; auch die schon früheren Resultate von
Infratest dimap in: Frankfurter Rundschau, 5.10.2002.
12Weiterhin konstitutiv Victor E. Frankl, Man’s
Search for Meaning, New York 1964.
13Vgl. Ulrich Geuter, Das bin ich! Oder?, in:
Psychologie Heute, 10/2003, S. 27.
14Vgl. dazu Eric Hoffer, Der Fanatiker und andere
Schriften, Frankfurt/M. 1999, S. 88 ff.
15Vgl. Walter, Stillgelegt und ausgebrannt, in:
Vorgänge, 1/2002, S. 11 f.
16Vgl. als Überblick: Gerd Langguth, Machtteilung
und Machtverschränkung in Deutschland, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B6/2000, S. 3 ff.
17Vgl. Ludger Helms, Deutschlands
„semisouveräner Staat“, in: ebd., B
43/2003, S. 8.
18Peter Graf Kielmansegg, Zukunftsverweigerung, in: FAZ,
23.5.2003.
19Vgl. auch Fritz W. Scharpf, Zur Wiedergewinnung
politischer Handlungsfähigkeit, in: Demokratie neu
denken. Verfassungspolitik und Regierungsfähigkeit in
Deutschland, hrsg. von der Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh 1988, S. 55 ff.
20Vgl. Werner Jann, Die beteiligungsorientierte
Kanzlerdemokratie – ein neues Politikmodell?, in:
Mitbestimmung, 9/2002,
S. 12.
21Vgl. Edwin Czerwick, Verhandlungsdemokratie –
ein Politikstil zur Überwindung von Politikblockaden,
in: Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2/1999, S.
423; Manfred G. Schmidt, Komplexität und Demokratie,
in: Ansgar Klein/Rainer Schmalz-Bruns (Hrsg.), Politische
Beteiligung und Bürgergesellschaft in Deutschland,
Bonn 1997, S.48.
22Vgl. Wachsende Reformbereitschaft in Deutschland, in:
Neue Zürcher Zeitung, 18.9.2003.
23Vgl. hierzu: Angela Merkel auf dem Sprung nach oben,
in: SZ, 28./29.6.2003.
24Vgl. Schröders Näschen, in: Rheinische Post,
18.9.2003; vgl. auch Renate Köcher, Die Schimäre
Generationengerechtigkeit, in: FAZ, 15.10.2003.
25Vgl. Mehrheit für Korrektur der Reformen, in: Die
Welt, 2.11.2003.
26Vgl. Wolfgang Merkel, Soziale Gerechtigkeit und die
drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus, in: Berliner
Journal für Soziologie, 2/2001, S. 3 ff; Jens Alber,
Besser als sein Ruf. Der Sozialstaat als erfolgreiches
Modell, in: WZB-Mitteilungen, 98/Dez. 2002, S. 24 ff.
27Vgl. Manfred G. Schmidt, Politiksteuerung in der
Bundesrepublik Deutschland, in: Frank Nullmeier/Thomas
Saretzki (Hrsg.), Strategiefähigkeit politischer
Parteien, Frankfurt/New York 2002, S. 26; ders., Immer noch
auf dem „mittleren Weg“? Deutschlands
politische Ökonomie am Ende des 20. Jahrhunderts, in:
ZeS-Arbeitspapiere (Zentrum für Sozialpolitik der
Universität Bremen), 7/1999, S. 5 ff.
Internationale Politik 5, Mai 2004, S. 11-24
Teilen
Themen und Regionen
Artikel können Sie noch kostenlos lesen.
Die Internationale Politik steht für sorgfältig recherchierte, fundierte Analysen und Artikel. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Angebot interessieren. Drei Texte können Sie kostenlos lesen. Danach empfehlen wir Ihnen ein Abo der IP, im Print, per App und/oder Online, denn unabhängigen Qualitätsjournalismus kann es nicht umsonst geben.