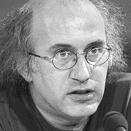Graue Bärte und schüttere Haare
Werkstatt Deutschland
Geboren in den Fünfzigern: Welche Zukunft hat die Linkspartei.PDS?
Peu à peu ist die Gysi-Lafontaine-Partei in soziale Räume eingedrungen, die in früheren Jahrzehnten noch von den Sozialdemokraten besetzt waren. Die Linkspartei hat ein Teil der sozialstaatlichen Kompetenzzuschreibung gewonnen, die einst allein der SPD zufiel. So hat sich die nach Westen erweiterte PDS von einem Nostalgie- und Traditionsverein ostdeutscher Nomenklatura Biographien erstaunlich erfolgreich zur Repräsentanz dezidiert linker Einstellungen im gesamtdeutschen Elektorat fortentwickelt. Demoskopisch bewegen sich ihre Werte verblüffend konstant bei etwa zehn Prozent.
Dennoch sind Einbruchstellen nicht zu übersehen. Die Linkspartei ist die politische Formation von linken Männern im mittleren Alter, des Typus Gewerkschafter mit Lederjacke, Holzfällerhemd, grauem Bart und schütteren Haaren. Hätten bei der Bundestagswahl 2005 allein Männer dieser Kohorte und Kultur wählen dürfen, dann wäre die Linkspartei locker auf 15 Prozent und mehr gekommen. Wenn es einen Nukleus der Linken in Deutschland geben mag, dann sind es unzweifelhaft die 1950er Geburtsjahrgänge. Gut jeder dritte Wähler von Linkspartei.PDS ist in diesen Adenauer-Ulbricht-Jahren zwischen Usedom und Bodensee zur Welt gekommen. Es ist schon bemerkenswert, dass trotz der innerdeutschen Grenze konstitutive Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Kohorte nicht zerschnitten wurden.
Die politische Sozialisation dieser Gruppe lag bekanntlich in den späten sechziger und siebziger Jahren, der Periode exklusiver wohlfahrtsstaatlicher Expansion also. Diejenigen, die in dieser Zeit geboren wurden, neigen dagegen am wenigsten zur politischen Linken. Nicht einmal jeder zehnte Wähler der Linken entstammt der 1970er Geburtskohorte. In dieser Gruppe sind wohlfahrtsstaatliche und gewerkschaftliche Dispositionen denkbar gering entwickelt. Bei den 18- bis 24-Jährigen hat die Linke zuletzt erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Dagegen kommen die rechtsextremistischen Parteien im Osten im Segment der Jungwähler in schöner Regelmäßigkeit auf über zehn Prozent Zustimmung. Der jugendliche Protest ist dort sicher noch fluide und politisch nicht final fixiert, doch er präsentiert sich bemerkenswert offen für rechtsextreme Deutungen, männerbündische Gesellungen und körperbetonte Aktionsstile.
Für die mittlere Zukunft muss das die Linkssozialisten noch nicht ängstigen. Sie verfügen über starke Fundamente in den geburtenstarken Jahrgängen, die eine sehr explizite politische Sozialisation erfahren haben und noch in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten die ausschlaggebende Gruppe der Altwähler stellen. Doch ist die fortwährende Reproduktion danach alles andere als gesichert, da die Jugend des Postindustrialismus mit den gewerkschaftlichen Modellen der Wohlfahrtsstaatlichkeit offensichtlich keine sonderlich positiv besetzten Erfahrungen verbindet. Andererseits: Die postindustrielle Gesellschaft wird sehr viel weniger sozial eingehegt sein. Schon jetzt hat sich der Wohlstandsgraben zwischen den Schichten weit geöffnet. Die Polarisierung zwischen oben und unten, zwischen Netzwerkfähigen und Netzwerklosen, zwischen Menschen mit und ohne Sozialkapital hat erheblich zugenommen. Insofern werden die Quellen, aus denen der Linkssozialismus zuletzt seine Wahlerfolge in Ost und West schöpfte, in den kommenden Jahrzehnten nicht versiegen. Der sozioökonomische Konflikt wird weiterhin Mentalitäten produzieren, die nach einer pointierten politischen Repräsentanz auf der linken Achse des Parteiensystems streben.
Von der objektiven Konfliktstruktur der Gesellschaft her dürfte das 21. Jahrhundert genügend Treibstoff für eine linke Partei in Deutschland bereithalten. Bezeichnend war, dass bei der Bundestagswahl 2005 neben der Linkspartei.PDS allein noch die Liberalen stattliche Zuwächse erzielten. Denn in gewisser Weise repräsentieren diese Parteien am prononciertesten die beiden Spektren der modernen Gesellschaft. Sie stehen im Frontbereich der zwei Abschnitte des sozioökonomischen Konflikts: die Linke als Partei dezidierter Wohlfahrtsstaatlichkeit hier, die Liberalen als Interessenagentur der wettbewerbszentrierten Marktgesellschaft dort. Kurzum: Die Linkspartei hat ein scharf konturiertes gegnerisches Äquivalent. Nichts aber schafft mehr Stabilität als ein kontrastierendes Pendant.
Nun übersetzen sich günstige Verhältnisse nicht automatisch in erfolgreiche Politik. Man kann gute Gelegenheiten beherzt nutzen – aber auch schmählich auslassen. Es kommt also auf fähiges Personal, vorausschauende Führung und umsichtiges Organisationsmanagement an. Insoweit ist die Linkspartei also selbst gefordert. Im Übrigen aber wird der Raum der Möglichkeiten ebenso durch die Strategie der politischen Mitwettbewerber begrenzt. Ob die Volksparteien sich künftig von den Opfern der Modernisierung noch weiter entkoppeln, ist – siehe Rüttgers – keineswegs sicher. Sollten sie es tun, dann allerdings wird die Linkspartei in der Tat eine stabile Größe im politischen System Deutschlands bilden. Besinnen sich Christ- und Sozialdemokraten hingegen stärker ihrer eigenen sozialstaatlichen Prägungen und berücksichtigen sie mehr als zuletzt die Sicherheitsbedürfnisse großer Teile auch ihrer Wählerschaft, dann wäre der Linkspartei der warme Humus entzogen. Dann käme für sie erst recht alles – mehr jedenfalls als bisher – auf ein exklusives Leistungsprofil an.
Prof. Dr. FRANZ WALTER, geb. 1956, lehrt Parteienforschung an der Universität Göttingen. Zuletzt erschien von ihm „Die ziellose Republik. Gezeitenwechsel in Gesellschaft und Politik“ (2006).
Internationale Politik 1, Januar 2007, S. 60 - 61.