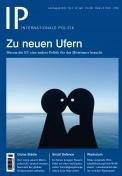Die Welt in der Nussschale
Zumindest in einem sind sich Israel-Skeptiker und die Konservativen unter den selbsterklärten „Freunden“ des Landes einig: „Die Strandpromenade von Tel Aviv ist nicht repräsentativ.“
Das überraschend gemeinsame Mantra gilt hier der Abwehr eines als apolitisch-hedonistisch wahrgenommenen Lebenskonzepts, das für die einen eine Art Lifestyle-Camouflage fragwürdiger israelischer Politik darstellt, für die anderen indessen gar eine Bedrohung für die Wehrhaftigkeit eines kleinen Landes und seiner Gesellschaft.
Aber was, wenn Tel Aviv – um eine etwas gewagte Analogie zu bemühen – tatsächlich zwischen Sparta und Athen liegt? Pars pro toto zeigt sich nämlich gerade auf jener Strandpromenade Israels ganze Komplexität, oder doch zumindest das verblüffend heterogene Wahrnehmungsmuster seiner Bewohner.
Man muss kein Alltagsphilosoph sein und jeden Text von Siegfried Kracauer oder Roland Barthes studiert haben, um bei den Reizstichworten Okkupation oder Iran die politische Relevanz des hier lebensweltlich Zelebrierten zu erkennen. Denn irgend-jemand drückt immer auf den Lautsprecherknopf, dort an der kleinen, in Beton eingefassten Felsenmauer unterhalb des Sheraton-Hotels. Und so erklingt beinahe regelmäßig und quer über die Promenade von Tel Aviv die charismatische Stimme des Abie Nathan, untermalt vom Rauschen des Meeres: „From somewhere in the Mediterranean: The Voice of Peace. Love, peace and understanding …“
Keine halbe Minute später hat sich dann in der Regel schon eine kleine Menschentraube um den winzigen Lautsprecher geschart, neben dem eine Plakette darüber informiert, dass fünf Kilometer von hier einst das Friedensschiff des Aktivisten Abie Nathan geankert hatte, um zwischen 1973 und 1993 täglich eben jene Friedensbotschaften auszusenden.
Und sofort entbrennt zwischen den Strandgängern – Eis schleckenden Flaneuren, Soldatinnen mit hoch ins Haar gesteckter Sonnenbrille, Familien und alterslos muskulösen Joggern, die mitten im Lauf anhalten – eine hitzige Diskussion: War Abie Nathan, vor zwei Jahren hochbetagt verstorben, womöglich ein naiver Vereinfacher und Schwärmer? Aber nein, widersprechen andere, Abie war doch ein Patriot, Kampfpilot im Unabhängigkeitskrieg von 1948, später allerdings Versöhner und Visionär.
Die Sonne steht hoch an diesem Sommernachmittag, die Zeitungen sind noch immer prall voll mit Nachrichten und Debatten über das iranische Atomprogramm, die verbalen Feindseligkeiten aus dem „neuen Ägypten“ und das nicht zuletzt von der Netanjahu-Regierung verantwortete Stocken der israelisch-palästinensischen Verhandlungen, und einer der Älteren sagt: „Versöhner und Visionär – schön und gut, zu Nasser ist er geflogen, um Frieden zu bringen, aber schon im nächsten Jahr haben sie uns ins Meer treiben wollen, damals, ’67.“
Und so wogt die spontane, nuancenreiche Debatte über Krieg und Frieden, feindliche Nachbarn und mentale Selbstblockaden hin und her, während im Hintergrund weiterhin Abie Nathans Stimme erklingt.
Vielleicht, denkt der Besucher, sollten die allzu oft vorschnellen westlichen Kommentatoren und Israel-Kritiker auch einmal diese Strandpromenade besuchen, um zu erfahren, auf welch hohem und atmosphärisch gänzlich sanktionsfreiem Niveau hier (wenn schon nicht im Kabinett der gegenwärtigen Regierung) diskutiert wird: Jenseits der Pauschalrhetorik von Pazifisten und Bellizisten, jenseits von Manichäismus, aber auch von allzu bequemer Äquidistanz.
„Wie billig“, grummelt einer, als kurz vor dem Verstummen des Lautsprechers John Lennons „Give peace a chance“ über die Promenade scheppert. Zwei junge homosexuelle Soldaten aber halten sich just in diesem Moment an den Händen, auf ihren Rücken die Waffen – ein Bild, das zu denken gibt.
Und dann sind da schließlich diese Augenblickswahrnehmungen beim Flanieren: Jüdische Äthiopier und nichtjüdische nigerianische Vertragsarbeiter beim gemeinsamen Flirten mit französischen Touristinnen, die sich aufgrund eines in Frankreich wachsenden Antisemitismus inzwischen hier sogar sicherer fühlen – und zwar im quirlig -gelassenen Tel Aviv, nicht etwa im aufgeheizt selbstgerechten Jerusalem.
Junge Leute von den Philippinen, die ältere Einheimische im Rollstuhl über die Promenade schieben, dazu aber auch schon Kinder mit eurasischen oder afrikanischen Gesichtszügen, die wie selbstverständlich auf Hebräisch sprechen und rufen, nicht zu vergessen die in Tel Aviv studierenden Araber aus Jaffa oder Haifa, die nun gerade etwas Sonne tanken.
Erste Anzeichen jener neuen umfassenderen israelischen Identität, auf die kritische Intellektuelle und Schriftsteller einer jüngeren Generation wie Nir Baram oder Ron Leshem so dringend hoffen? Wie auch immer: Man kann schwerlich vom Nahen Osten reden und gleichzeitig vom Wunder dieser Strandpromenade schweigen.
MARKO MARTIN lebt als Schriftsteller und Publizist in Berlin. Zuletzt erschien in der Anderen Bibliothek sein Erzählband „Schlafende Hunde“.
Internationale Politik 4, Juli/ August 2012, S.128-129