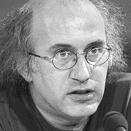Die Waffen gestreckt
die Zeit für einen neuen Konservatismus ist reif, doch die CDU lebt lieber liberal
Für alteingesessene Konservative und strenggläubige Katholiken sind das keine leichten Zeiten. Eine christdemokratische Kanzlerin in zweiter Ehe. Ein CDU-Bürgermeister, der sich zu seiner Homosexualität bekennt. Ein christdemokratischer Ministerpräsident, der öffentlich kundtut, dass seine Ehe gescheitert sei. Eine schwangere, aber unverheiratete Staatsministerin im Kanzleramt, die zugleich dem Zentralkomitee der Katholiken angehört. Als durch und durch liberale Menschen kommentieren wir natürlich: kein Problem. Und: Gut, dass es mittlerweile in der Gesellschaft so vielfältig, bunt, so wenig bigott, heuchlerisch, verdruckst zugeht. Soll jeder nach seiner Façon glücklich werden.
Im Grunde ist die bundesdeutsche Gesellschaft jedenfalls über all das bemerkenswert gelassen zur Tagesordnung übergegangen. Nicht so aber die CDU selbst. Die Mitglieder in der Fläche und an der Basis, gleichsam zwischen Heiligenstadt und Meppen, Warendorf und Passau, tun sich ersichtlich schwer mit der Selbstsäkularisierung ihrer Anführer. In altchristdemokratischen Kreisen galt das muntere Paarungsverhalten von Fischer und Schröder noch apodiktisch als verwerflicher Ausdruck einer wertentbundenen und unbürgerlichen Lebensweise. Mit der Empörung darüber konnten die harten CDU-Strategen die eigenen Traditionstruppen verlässlich und militant in die Wahlkämpfe schicken. Damit dürfte es künftig vorbei sein. Mindestens kulturell-lebensweltlich also ist das Land intakt großkoalitionär, wird gar immer mehr zu einer Allparteienkoalition.
Zugleich wird das traditionelle Terrain der Christdemokraten schmaler und schmaler, da zunehmend weniger Menschen im nachtraditionellen Deutschland noch treue Kirchgänger und gehorsame Adepten päpstlicher Moralimperative sind. Diese sozialkulturelle, von Roten und Grünen kräftig geförderte Entwicklung öffnete den Raum eben auch für christdemokratische Würdenträger, neue Liebes- und Paarbeziehungen zu beginnen. In den ersten Jahrzehnten der rheinisch-katholisch geprägten Altbundesrepublik wäre das für einen prominenten CDU-Repräsentanten politisch sehr viel weniger gefahrlos gewesen, weil er damit in den eigenen Reihen auf kräftige Ablehnung gestoßen wäre.
Insofern profitieren nun auch christdemokratische Spitzenpolitiker ganz privat von einer Entwicklung, die der Union als Partei indes noch erhebliche Probleme bereiten mag. Schließlich sind die Vorboten davon bereits seit Ende der neunziger Jahre unschwer zu erkennen. Denn durch die Abschwächung des einst so emotionalisierenden kulturellen Konflikts mit der moralisch als lasziv denunzierten Linken gelingen der CDU keine aggressiven Lagerwahlkämpfe à la Adenauer und Kohl mehr. Die militante Gesinnungsfront dafür ist zerbröselt. Die normative Basis in der christlichen Anhängerschaft ist nach vielen Jahrzehnten homogener Eintracht gesprengt; die einst tief konservativen Moralüberzeugungen, Ethiken, Glaubensinhalte im Bürgertum Deutschlands haben sich seit den sechziger Jahren gelockert und gelöst. Das junge und mittelalte Bürgertum in Deutschland ging und geht ebenso zweite und dritte Ehen ein, will sich ebenso wenig für alle Zeiten in Partnerschaften, Religionsgemeinschaften und lokalen Sozialkontrollen zwingen und festbinden lassen wie der früher gerade deshalb wütend geächtete linke Gegner.
Für die CDU als Partei aber wird es dadurch immer schwieriger. Denn sie verliert immer mehr die Klammern, die diese heterogene Volkspartei einst zusammenhielten. Die Union verstand sich über Jahrzehnte als politische Kampfgemeinschaft. Doch solche Truppen brauchen das fest umrissene Feindbild. Früher waren das der Sozialismus, die Roten, die linken Gegner des Privateigentums. Es gibt sie nicht mehr. Zu den kittenden Feinden der Christlichen Union gehörten auch die Kritiker des Nationalen, die Polemiker gegen Heimat und Patriotismus. Doch dieser Typus befindet sich heute massenhafter im global agierenden Bürgertum als im bräsig–kleinbürgerlichen Restsozialismus. So blieben den Christdemokraten alten Schlages zuletzt nur noch die Lebensweise, das Kulturelle, das Moralische – das Antiachtundsechzigerhafte. Nun ist auch das perdu. Die Dämme, die die Union gegen den libertären Postmaterialismus errichtet hatte, sind gebrochen. Die neue christdemokratische Parteielite hat die Waffen gegen das, was die Filbingers, Strauß’ und Dreggers noch verächtlich den „Zeitgeist“ nannten, gestreckt.
Die Liberalisierung der Partei mag fällig gewesen sein. Doch sie hat unzweifelhaft eben auch zu einer spirituellen Leere geführt. In der modernen CDU herrscht normativ gewissermaßen eine Kantinenmentalität: Jeder nimmt sich aus den Vitrinen, was ihm kulinarisch gerade gefällt. Deshalb aber scheut die CDU die entscheidungsorientierte Diskussion über die konstitutiven Wertefragen von Politik und Gesellschaft. Sie fürchtet die Sprengkraft, wenn sich Konservative und Liberale, Traditionalisten und Modernisierer, Globalisierer und Heimatmenschen, Verlierer und Gewinner im Klein- und Großbürgertum über Normen und Ethiken des künftigen Zusammenlebens, also gleichsam auf ein gemeinsames Sinnmenü, einigen müssten. Denn zu einer solchen Werteintegration ist das mehrheitlich verweltlichte Bürgertum in Deutschland kaum mehr in der Lage.
So aber sind die Grundlagen des alten christdemokratischen Erfolgsmodells un-übersehbar porös geworden. Die bemerkenswert geschmeidige Elastizität dieses Modells war immer abhängig von den festen Wurzeln, die es in den katholischen Lebenswelten besaß. Die Loyalität der Traditionstruppen sicherte den politischen Spielraum der Führungsmannschaften ab. Die Autorität der Kirche war die Quelle für diese Loyalität. Der gemeinsame Glaube wiederum verband verschiedene soziale Schichten und Generationen. Die Traditionsstoffe hatten also die gesellschaftliche Integration ermöglicht, von der die Volkspartei nur zehrte, die sie aber als säkularisierte liberale Zweckgemeinschaft nicht herzustellen vermochte. Eben das wird künftig zum Problem, da die traditionsgestützten Voraussetzungen von politischer Elastizität und komplexer Integration unaufhaltsam dahinschwinden.
Merkwürdig ist das schon. Denn der Konservatismus in Deutschland verliert die Schlacht gegen den Wertewandel in einer Zeit, in der doch dieser an Flair, Zauber und Attraktivität ebenso massiv verliert. Wir erleben gerade den Beginn eines Wandels des Wertewandels. In den Tiefenschichten der Gesellschaft wachsen die Bedürfnisse nach Bindung, Zuordnung, Sicherheiten, wenn man so will: nach Fahnen, Wimpeln, Gesang und Gemeinschaft. Kaum einmal in den letzten 40 Jahren war das kulturelle Terrain günstiger für einen politischen Konservatismus in Deutschland. Doch die Konservativen haben seltsamerweise politisch resigniert, als die Quellen für ihre Renaissance kulturell gerade wieder zu sprudeln begannen.
Prof. Dr. FRANZ WALTER, geb. 1956, lehrt Parteienforschung an der Universität Göttingen. Zuletzt erschien von ihm „Die ziellose Republik. Gezeitenwechsel in Gesellschaft und Politik“ (2006).
Internationale Politik 8, August 2006, S. 68‑69