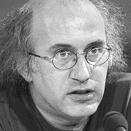Die SED: Am Anfang war nicht nur Zwang
Nach 60 Jahren „Einheit der Arbeiterklasse“ wird wieder um die Geschichte gestritten
Ende April wurde in Berlin wieder auf einigen Symposien über die Deutung von Geschichte gestritten. Es ging um die Bildung der SED vor exakt 60 Jahren. Die Sozialdemokraten schlüpfen in diesem Zusammenhang gern in die Märtyrerrolle. Zumindest auf historischen Gedenkveranstaltungen gerieren sie sich bevorzugt als Opfer und Widerständler. Eine solche Selbstinterpretation ist keineswegs rundum unlegitim, aber sie ist doch auch ein wenig – zu – selbstgerecht.
Auch wenn die Sozialdemokraten gegenwärtig ungern daran erinnert werden: Besonders im industriellen Mitteldeutschland, dem heutigen Osten der Republik, propagierten sie nach Kriegsende zunächst besonders forsch – weit stärker jedenfalls als die anfangs zaudernde KPD – die „Einheit der Arbeiterklasse“. Auf den Landesparteitagen der ostzonalen Sozialdemokratie im Oktober 1945 durften sich alle Redner, die den „Bruderpakt“ mit den Kommunisten feierten, des stürmischen Beifalls der übrigen Delegierten sicher sein. Durch russische Bajonette erzwungen war diese Akklamation zu dem Zeitpunkt keineswegs.
Doch natürlich: In ihrem Einheitsimpetus hatten die Sozialdemokraten zwischen Rostock und Zwickau nicht die trübe Realität der späteren SED-Diktatur vor Augen. Im Grunde war die Perspektive nostalgisch. Die mitteldeutschen Sozialdemokraten wünschten sich die gute alte Bebel-SPD des Kaiserreichs zurück, als die Welt des Sozialismus noch in Ordnung war, die sozialistische Arbeiterbewegung parteipolitisch geschlossen agierte und eine Periode kontinuierlichen Wählerwachstums durchlebte. Die elendige Weimarer Zeit und die Spaltung der Arbeiterbewegung sollten ungeschehen gemacht werden.
Im Laufe der Herbstmonate 1945 verflog allerdings bei vielen Sozialdemokraten die Begeisterung für die Allianz mit den Kommunisten. Jetzt häuften sich die Beschwerden aus den Ortsvereinen über üble Tricks und Intrigen. Der SPD fehlten die besoldeten Funktionäre, während die KPD ihre Berufsrevolutionäre noch in das entlegenste Dorf senden konnte. Die Sozialdemokraten klagten über Mangel an Papier für Publikationen; die Kommunisten hatten reichlich davon. Vor allem durften sie ihre früheren Suborganisationen nicht neu begründen. Das verbitterte die mitteldeutschen Parteimitglieder, die zudem an den vasallenhaften Devotionen der Kommunisten gegenüber den Sowjets Anstoß nahmen.
Bei den Sozialdemokraten also kehrte sich die Einheitsstimmung um. Im Gegenzug machte nun die kommunistische Parteileitung Tempo; jetzt steuerte sie mit Macht und Verve die Einheitspartei an. Die leninistischen Kader hatten die Partei mittlerweile hinreichend konsolidiert und strategisch auf Kurs gebracht. Bei der SPD war es anders. Fatal wirkte sich hier aus, dass die einheitskritischen Arbeiter an der Basis der SPD nicht mit dem Kreis fusionsunwilliger Sozialdemokraten an der Parteispitze zusammenkamen. Die Einheitsgegner unten fanden kein Sprachrohr bei den Einheitsfeinden oben, um Unmut und Protest zu vokalisieren. Das war das Dilemma der Einheitsopponenten in den sozialdemokratischen Vorständen: In kleinen Zirkeln gestanden sie sich ihre Abneigung gegen die Kommunisten ein. In der Öffentlichkeit aber mussten sie sich als Befürworter der Einheit aufführen. Hätten sie sich den Einheitspressionen mit offenem Visier entgegengestellt, wären sie von den Kommandanturen sofort verhaftet worden. Mehreren couragierten Sozialdemokraten widerfuhr exakt dies. Einige bezahlten ihren Mut mit dem Tod.
Indes: Keineswegs alle leitenden Sozialdemokraten in der SBZ teilten die Widerständigkeit gegenüber der Einheit. Insbesondere die beiden SPD-Landesvorsitzenden von Thüringen und Sachsen wetteiferten gar miteinander, als Väter der „Einheit der Arbeiterklasse“ in die Geschichtsbücher des Sozialismus einzugehen. Doch: Warum haben sich die meisten Sozialdemokraten trotz aller Distanz letztlich nicht verweigert; wieso haben die Delegierten der SPD-Parteitage die Einigungsresolutionen einstimmig passieren lassen; weshalb haben die früheren Wähler der SPD im Herbst 1946 dann auch der SED ihre Stimme gegeben? Da war zunächst die traditionelle „Parteidisziplin“. Disziplin hatte in der SPD lange einen hohen, nachgerade ethisch verpflichtenden Wert. Eine Partei, die historisch mehrere Male vom Establishment verfolgt worden war, durfte sich keine individualistischen Kapriolen leisten, musste die Order der Parteiführung geschlossen befolgen. Das zumindest war stabile sozialdemokratische Überzeugung. Und da die Parteiführungen auf Zonen- und Länderebene der SBZ seit Februar 1946 für eine zügige Vereinigung von SPD und KPD plädierten, stellten die Fußtruppen ihre Skrupel zurück. Die kollektive Parteiräson wog schwerer als der Zweifel des Einzelnen.
Zudem hofften die Sozialdemokraten, die Kommunisten in der neuen Einheitspartei deutlich majorisieren zu können. Schließlich brachte die SPD eine weit größere Mitgliederzahl in die SED ein. Überdies war die dann im April 1946 gegründete SED zu Beginn noch kein leninistischer Monolith. Das ursprüngliche Organisationsstatut der SED entsprach zur einen Hälfte sozialdemokratischen, zur anderen Hälfte kommunistischen Strukturprinzipien. Auf manche Fragen der Politik gaben SPD und KPD programmatisch ähnliche Antworten: Beide setzten sich für eine umfassende Bodenreform ein; beide steuerten eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens an; beide hielten viel von der staatlichen Verfügung über die Produktionsmittel. Nicht alles davon war im Übrigen gänzlich abwegig.
Bedenklicher dagegen war etwas anderes. Wahrscheinlich haben gerade die innerhalb der SPD in Deutschland am weitesten links stehenden mitteldeutschen Sozialdemokraten die fundamentalen Differenzen zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten bis 1946 nie hinreichend wichtig genommen. Über den freiheitsfeindlichen Charakter der leninistischen Ideologie sahen die Sozialdemokraten in den alten Industrierevieren der Sowjetischen Besatzungszone naiv hinweg. Höher stand ihnen die gemeinsame soziale Herkunft aus der industriellen Arbeiterschaft und der identitäre Rekurs auf den „Sozialismus“. Gerade darin enthüllt sich 1945/46 das historische Debakel der proletarisch-sozialistischen Weltanschauung marxistischer Prägung. In dieser Ideologie galt als Zukunftsgruppe einzig die Arbeiterklasse, die in ihrer geschichtswendenden Bedeutung von SPD wie KPD gleichermaßen kanonisiert wurde. Das proletarisch- sozialistische Glaubenssystem gab vor, die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte dechiffriert zu haben. Es beanspruchte, Weg und Ziel zur finalen Lösung aller gesellschaftlichen Konflikte zu kennen. Eben dies führte – und nicht nur über die KPD – zumindest in die SED, mag sich die Sozialdemokratie mit diesen Grautönen ihrer Geschichte auch heute schwer tun.
Prof. Dr. FRANZ WALTER, geb. 1956, lehrt Parteienforschung an der Universität Göttingen. Zuletzt erschien von ihm „Die ziellose Republik. Gezeitenwechsel in Gesellschaft und Politik“ (2006).
Internationale Politik 5, Mai 2005, S. 78 - 79