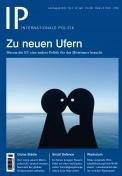Finanzspritzen und Erfahrungsschätze
Wie Europa die Volkswirtschaften Nordafrikas unterstützen kann
Um den südlichen Mittelmeeranrainern mit ihren sehr heterogenen Strukturen wirtschaftlich auf die Beine zu helfen, muss die EU individuelle Strategien entwickeln. Allein wird sie die enorme Unterfinanzierung der Volkswirtschaften jedoch nicht bewältigen. Helfen kann sie vor allem mit Knowhow – auch dank ihrer eigenen Transformationserfahrung.
Zwar bietet kein nordafrikanisches Land derzeit Grund für wirtschaftlichen Optimismus, doch nirgendwo sind die sozioökonomischen Hürden so hoch wie in Ägypten. Dies liegt nicht zuletzt an der schieren Bevölkerungsgröße: Mit derzeit 83,7 Millionen Einwohnern hat es fast ebenso viele Einwohner wie die restlichen nordafrikanischen Mittelmeeranrainer Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien zusammen. Die Bodenschätze Ägyptens sind zwar beträchtlich, vor allem im Gassektor, reichen aber bei weitem nicht aus, um genügend Einkommen für die gesamte Bevölkerung zu generieren. Der Tourismus, Arbeitgeber für etwa 2,5 Millionen Ägypter und wichtiger Devisenbringer, ist nicht nur von der wirtschaftlichen Situation in Europa abhängig, sondern auch von der politischen Stabilität im Land und in der Region.
In den letzten Jahren der Mubarak-Herrschaft hatte Ägypten beeindruckende Wirtschaftserfolge vorzuweisen. Der Reform- und Privatisierungskurs brachte enorme Zuwachsraten, von der Weltbank wurde das Land im 2008er Doing-Business-Report als globaler „Top Reformer“ bezeichnet. International vergleichende Indizes wie der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung zeigen aber, dass das Reformtempo nach 2008 fast gänzlich zum Erliegen kam und man nicht in ausreichendem Maße Wert auf sozialpolitische Flankierung der Privatisierungsmaßnahmen legte. Verarmung breiter Schichten und eine Verschärfung der sozialen Kluft waren die Folgen.1
Die Revolution brachte enorme Belastungen für die ohnehin schwache Volkswirtschaft. Das Wirtschaftswachstum fiel 2011 auf magere 1,8 Prozent (bei fast 2 Prozent Bevölkerungswachstum), Investitionen und Tourismuszahlen gingen rapide zurück, sodass im Mai 2011 laut offiziellen Angaben 70 Prozent der Ägypter unter der Armutsgrenze lebten; die Statistiken wiesen eine Arbeitslosenquote von 25 Prozent, bei der Jugend gar von 60 Prozent aus. Zudem stieg die Staatsverschuldung auf 85 Prozent des BIP, die Neuverschuldung erreichte 10 Prozent.2 Entsprechend groß sind die benötigten Finanzhilfen. Schätzungen des IWF prognostizieren einen Bedarf von acht bis neun Milliarden Euro für das laufende Haushaltsjahr.3 Diese Größenordnung macht die Kooperation mehrerer Geber unabdingbar, die EU allein wäre überfordert. Die USA, die Golf-Staaten, China, Russland sowie Weltbank und IWF haben Hilfen angekündigt oder geleistet.
Blick zurück nach vorn
Auf den Arabischen Frühling reagierte die EU erstaunlich schnell (wenn auch von Beobachtern zuweilen für die Art und Weise kritisiert):4 Die EU-Kommission stellte 30 Millionen Euro als Soforthilfe für Flüchtlinge und Opfer der Kampfhandlungen zur Verfügung; die für die MENA-Staaten regulär vorgesehenen Mittel aus der Europäischen Nachbarschaftspolitik in Höhe von 5,7 Milliarden Euro wurden um 1,2 Milliarden Euro für den Zeitraum 2011–2013 erweitert. In der Anfang März 2011 veröffentlichten Strategie der neuen „Partnerschaft für Demokratie und geteilten Wohlstand“ zwischen EU und südlichen Mittelmeerstaaten nimmt die Wirtschaftsförderung, insbesondere die Stärkung kleiner und mittelständischer Betriebe, breiten Raum ein.5 Das Budget der Europäischen Investitionsbank (EIB), die seit 2002 schon 168 Projekte in den neun mediterranen EIB-Partnerländern mit 13 Milliarden Euro unterstützt hat, wurde für die MENA-Region von vier auf fünf Milliarden Euro erhöht.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 1991 zur Unterstützung des demokratischen Wandels in Zentral- und Osteuropa gegründet, weitete ihr Engagement über den Kontinent und die UdSSR-Nachfolgestaaten hinaus aus und startete in der zweiten Jahreshälfte 2011 eine „Transition to Transition“-Initiative mit allen arabischen Reformländern in einem Gesamtumfang von 2,5 Milliarden Euro.6 Ziel ist es, die in den neunziger Jahren mit der Transformation in Europa gemachten Erfahrungen auf den arabischen Kontext zu übertragen, um Lehren für wirtschaftspolitisches Handeln zu ziehen.
Die Erfahrungen mit der eigenen Transformationsgeschichte sind ein besonderer Pluspunkt für Europa. Bei allen Unterschieden lässt sich eine Reihe von Parallelen zwischen den ehemals sozialistischen Staaten Europas und den heutigen arabischen Volkswirtschaften erkennen, insbesondere bei der Privatisierung von staatlichen Großbetrieben und der Schaffung eines mittelständisch geprägten Unternehmertums. Die mittelmeerübergreifenden Beziehungen waren bislang keine berauschende Erfolgsgeschichte, brachten aber immerhin den Abschluss bilateraler Assoziationsabkommen zwischen der EU und den Mittelmeeranrainerstaaten (Ausnahme: Libyen und Syrien) als Basis für den Aufbau einer Freihandelszone über einen Zeitraum von etwa 15 bis 20 Jahren. Kurzfristig steht neben der Budgethilfe die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit an erster Stelle. Reformen auf dem Bildungssektor sind nur ein Schritt in diese Richtung. Da Universitätsabsolventen überproportional unter den Arbeitslosen vertreten sind, muss die Aufnahmefähigkeit der Arbeitsmärkte für gut ausgebildete Fachkräfte erhöht werden, etwa durch eine Stärkung der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Bisher leiden alle Länder Nordafrikas an einem Mangel an international wettbewerbsfähigen Unternehmen.
Schließlich muss die nordafrikanische Landwirtschaft modernisiert werden. Keines der Länder produziert ausreichend Nahrungsmittel für den Eigenbedarf, die Gesellschaften sind somit anfällig für Schwankungen der Weltmarktpreise, die zuletzt 2008 zu einem rapiden Anstieg der Lebensmittelpreise in Nordafrika führten. Hier ist eine Zusammenarbeit zwischen der EU, FAO, Weltbank sowie EIB geplant. Eine gänzliche Aufhebung der Exportbeschränkungen für Agrarprodukte aus Nordafrika oder, wie auch vorgeschlagen, gar eine Ausweitung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik auf Nordafrika sind aufgrund der protektionistischen Neigungen in Europa kaum durchsetzbar, würden allerdings spürbar dazu beitragen, die Wirtschaft der Region anzukurbeln.7
Die wirtschaftlichen Probleme der südlichen Mittelmeerstaaten sind enorm und damit auch die Herausforderungen für die EU-Förderprogramme. Sollte sich die sozioökonomische Lage nicht verbessern oder zumindest stabilisieren, ist eine Radikalisierung der Politik zu befürchten. Die EU jedoch ist, gerade angesichts der Euro-Krise, nicht in der Lage, sämtliche benötigten Unterstützungsleistungen alleine zu erbringen. Daher wird es auf ein Zusammenspiel der internationalen Gebergemeinschaft ankommen, in der auch Länder eine stärkere Rolle spielen, die wenig bis gar nichts mit westlichen Konditionierungsvorstellungen gemein haben. Das verheißt zunächst wenig Gutes für die politische Zukunft der betroffenen Gesellschaften. Zudem wird die EU um ihren Status als primärer Handelspartner Nordafrikas kämpfen müssen – die engere Anbindung der Länder an den EU-Binnenmarkt ist deswegen von zentralem strategischen Interesse für die Europäische Union.
Dr. JAN VÖLKEL arbeitet als Wissenschaftler am Robert Schuman Centre for Advanced Studies des European University Institute in Florenz.
- 1Maria C. Paciello: Egypt’s last decade. The emergence of a social question, in Daniela Pioppi (Hrsg.): Transition to what? 2 Egypt’s uncertain departure from NeoAuthoritarianism, Washington 2011, S. 7–28.
- 2Ulrich Schinabeck und Verena Strobel: Länderanalyse Ägypten, München 2012, S. 4.
- 3Leila Hatoum: IMF Awaits Economic Plan From Egypt, Wall Street Journal Online, 2.5.2012.
- 4Tobias Schumacher: New neighbors, old formulas? The ENP one year after the start of the Arab spring, in: ArmandoGarcia Schmidt und Hauke Hartmann (Hrsg.): The Arab Spring. One Year After. Europe in Dialogue 2/2012, Gütersloh, S. 87–104.
- 5Europäische Kommission: A partnership for democracy and shared prosperity with the Southern Mediterranean, COM (2011) 200 final.
- 6Europäische Kommission: The EU’s response to the „Arab Spring“. MEMO/11/918.
- 7Mohamed Hedi Bchir, Hakim Ben Hammouda, Mondher Mimouni und Xavier Pichot: The Necessity to Balance the Barcelona Process: Economic Integration between North Africa and the European Union, Journal of Economic Integration, 2/2011, S. 329–360.
Internationale Politik 4, Juli/ August 2012, S22-25