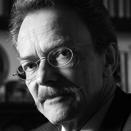Das Kreuz des Musterknaben
Brav erträgt Irland die Konditionen seiner Rettung – zum eigenen Nachteil?
Von allen Sorgenkindern des Euro-Raumes hat Irland die besten Aussichten, bald wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Doch die eherne Doktrin der Europäischen Zentralbank (und der Bundesbank) verhinderte bisher einen glatten Neustart. Und so überlegen sich zahlreiche Iren, ob sie vielleicht – entgegen ihrem Naturell – auch mal auf den Tisch hauen sollten.
Die Spezies Mensch ging aus dem Leime und mit ihr Haus und Staat und Welt. Ihr wünscht, daß ich’s hübsch zusammenreime, und denkt, daß es dann zusammenhält? So dichtete Erich Kästner 1930 unter dem Titel „Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?“ Er antwortete selbst: „Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt.“
Hier allerdings wollen wir mit dem Positiven beginnen: Die Ireland Inc. verdient Geld. 2011 lagen die Exporte von Gütern und Dienstleistungen mit knapp 167 Milliarden Euro sogar ein Stückchen über der gesamten Wirtschaftsleistung. Allein der Überschuss aus dem Warenhandel betrug über 44 Milliarden – nach Deutschland und den Niederlanden war das der dritthöchste Überschuss in der EU, obwohl die Inselrepublik bloß viereinhalb Millionen Einwohner zählt. Irland hat eine der offensten Volkswirtschaften der Welt; daraus ergibt sich zwingend, dass der Ruf des Landes auf den Kapitalmärkten und in den Chefetagen der multinationalen Konzerne ein kostbares Pflänzchen ist.
Das politische System der Republik ist gewiss nicht über jede Kritik erhaben. Im Gegenteil: Der vorherrschende Klientelismus und die daraus resultierende Unwilligkeit, radikal zu handeln, lassen selbst wohlmeinende Beobachter bisweilen aus der Haut fahren. Doch die Behutsamkeit bringt Stabilität. Keine irische Regierung verfügte je über eine derart erdrückende parlamentarische Mehrheit wie die amtierende Koalition aus den Fine-Gael- und Labour-Parteien. Im Februar 2011 sorgten die irischen Wähler für einen dramatischen Umsturz, indem sie die bisherige Regierungspartei Fianna Fáil dezimierten und deren kleinen Regierungspartner, die Grünen, eliminierten. Allein: Auch nach fast 30 Jahren intensiver Beobachtung wäre es schwierig, den minimalen Unterschied zwischen Fine Gael und Fianna Fáil in weniger als tausend Sätzen zu Papier zu bringen. Die historisch stets kleinere bürgerlich-populistische Fine Gael ersetzte die bürgerlich-populistische Fianna Fáil. Es gibt keinen dubiosen rechten Flügel im Parteienspektrum, und auf der Linken tummeln sich handzahme Kreaturen – zum Teil mit terroristischer Vergangenheit.
Die instinktive Neigung zur Mäßigung erstreckt sich auch auf die Gewerkschaften: Sie demonstrieren gegen in ihren Augen herzlose Sparprogramme, aber nur in der Mittagspause oder an Wochenenden. Ein letztes Positivum: Auf den Sekundärmärkten werden zehnjährige irische Staatsanleihen zu rund 4,5 Prozent gehandelt, zweijährige stehen unter 2 Prozent. Das ist ermutigend für die Rückkehr in die Kapitalmärkte. Vom 1. Januar 2014 an will Irland die Vormundschaft der Troika verlassen.
Ich will nicht schwindeln. Ich werde nicht schwindeln. Die Zeit ist schwarz, ich mach euch nichts weis. Es gibt genug Lieferanten von Windeln. Und manche liefern zum Selbstkostenpreis.
Anfang Dezember präsentierte der irische Finanzminister Michael Noonan den fünften Sparhaushalt in Folge. Nach all den quälenden Kürzungen und Abgabenerhöhungen beträgt der Fehlbetrag für 2013 immer noch über 15 Milliarden Euro. Bei Einnahmen von gut 40 und Ausgaben von knapp 56 Milliarden ist das ein bedenkliches Defizit von 7,5 Prozent der erwarteten Wirtschaftsleistung (nach einigen arithmetischen Tricks, um die Rekapitalisierung der Banken auszuschließen). Bis zum 31. Dezember 2012 betrug die „fiskalische Korrektur“ (die Kombination aus Ausgabenkürzungen und Abgabenerhöhungen) rund 24 Milliarden Euro, das ist nach den Berechnungen der OECD ein europäischer Rekord, gemessen an der Größe der Volkswirtschaft. Mit dem Budget für 2013 wären 85 Prozent der notwendigen Korrekturen vollzogen. Die akkumulierte Staatsschuld, die vor der Krise netto auf unter 20 Prozent der Wirtschaftsleistung reduziert worden war, wird 2013 ihren mutmaßlichen Höchstwert von 121 Prozent des Bruttoinlandprodukts erreichen. Autsch.
Zwei Probleme
Irland hat zwei Probleme, die natürlich verknüpft sind. Aber die beiden Lösungen gehorchen gänzlich unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten: Das Ungleichgewicht zwischen den jährlichen Einnahmen und Ausgaben muss von den Iren selbst beseitigt werden. Weitere Sparhaushalte sind unvermeidlich. Der Alleingang – der Austritt aus der Euro-Zone – wird nicht einmal erwogen, denn die Alternative wäre ja eine reuige Rückkehr zur britischen Sterling-Zone (nach 34-jähriger Unterbrechung), die ihrerseits mit der Abkoppelung von der Europäischen Union liebäugelt.
Doch parallel dazu schwärt ein anderes Problem: Etwa 30 Prozent der irischen Staatsschuld flossen in die einheimischen irischen Banken. Eine Studie des Internationalen Währungsfonds konstatierte vor ein paar Monaten, dass die irische Bankenrettung etwa 41 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gekostet habe. Das ist ein Weltrekord. Die 63 Milliarden Euro, die direkt in die Banken flossen, liegen bis zum letzten Cent auf den Schultern des irischen Steuerzahlers, obwohl die Nutznießer dieser Großzügigkeit in Frankfurt, Paris und London sitzen. Aber weil die Iren so pflegeleicht sind, huldigen die EU und vor allem die EZB unverdrossen ihren heiligen Prinzipien (die sie für Griechenland längst gebrochen haben).
Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, müssen wir ausholen: Das irische Wirtschaftswunder zerfällt in zwei gänzlich unterschiedliche Phasen. Zwischen der Mitte der neunziger Jahre und 2001 vollzog die irische Wirtschaft einen Quantensprung. Eine kluge Einkommens- und Fiskalpolitik, verbunden mit einer vorteilhaften Demografie und einer selektiven Förderung ausländischer Investoren führte zu dramatischem Wachstum, das von Exporten und Produktivitätsgewinnen genährt wurde.
Die EU förderte diese Entwicklung mit ihrem Beharren auf langjährigen, integrierten Plänen für die Verwendung ihrer Transfers (Struktur- und Kohäsionsfonds). In dieser Zeit verdiente Ireland Inc. echtes Geld. Nach einer kurzen Verschnaufpause während der Dotcom-Bubble von 2001 kippte das Modell. Für die nächsten Jahre bis zum Eklat „haute“ Irland den akkumulierten Mehrwert innerhalb der einheimischen Wirtschaft „auf den Kopf“. Die Bauindustrie erreichte zeitweise einen Anteil von 15 Prozent an der Wirtschaftsleistung, der Konsum auf Pump eskalierte. Die Regierung goss Öl ins Feuer durch Steuervergünstigungen, namentlich für Hotels. Immobilienpreise verzehnfachten sich (sic). Fast alle (einschließlich des Autors) sagten trotz dieses Irrsinns eine „sanfte Landung“ voraus. Demografische Gründe schienen diese Sicht zu rechtfertigen. Der grundlegende Irrtum bestand wohl darin, dass wir einerseits nicht wussten, wie korrupt die Banken in ihrer Kreditvergabe für „kommerzielle“ Projekte waren und dass wir andererseits ausblendeten, wie absurd die Millionenbeträge waren, die für matschige Wiesen anderthalb Autostunden westlich, nördlich und südlich von Dublin bezahlt wurden, in der Hoffnung, den Pendler-Radius zu erweitern.
Parallel zu diesen krebsartigen Entwicklungen in der einheimischen Wirtschaft verschlechterte sich die Wettbewerbsfähigkeit der mehrheitlich ausländisch gesteuerten Exportindustrie. Im Nachhinein scheint es sinnig, dass Viagra, das in Irland für den europäischen Markt produziert wird, dabei eine bedeutsame Rolle spielte (das ist, im Übrigen, bis heute der Fall).
Die Struktur des Fiskus
Der irische Finanzminister jener Jahre (1997 bis 2004), der spätere EU-Kommissar Charlie McCreevy, ist ein Spieler. Niemand kann so mit Zahlen jonglieren wie der diplomierte Buchhalter, sei es über die Wahlchancen in einem bestimmten Wahlkreis, sei es über die Gewinnchancen eines rätselhaften Rennpferds. Doch als Kassenwart blieb er erstaunlich primitiv: Wenn ich Geld habe, gebe ich es aus, lautete sein Motto. So stiegen die irischen Staatsausgaben zwischen 1997 und 2007 um 163 Prozent, deutlich rascher als in irgendeinem anderen EU-Staat. Das führte nicht zu Defiziten, war aber dennoch töricht. McCreevy kopierte letztlich das Finanzierungsmodell der britischen Bank Northern Rock und der (in Dublin beheimateten) deutschen Depfa: langfristige Verbindlichkeiten und kurzfristige Forderungen. Das reichlich sprudelnde Einkommen des irischen Fiskus nährte sich vom fiebrigen Immobilienmarkt: Mehrwertsteuer, „Stempelsteuer“ (stamp duty) bei Vertragsabschluss – überall verdiente der Staat mit, wenn Spekulanten und irregeleitete junge Familien dumm investierten. Angesichts der (kurzfristig) vollen Kassen senkten opportunistische Politiker die Einkommens- und die Kapitalertragsteuer und schmälerten so die Steuerbasis.
Aus der Rückschau können wir erkennen, dass die irische Blase schon 2007 platzte. Doch die damals liquiden Geldmärkte verschleierten das Problem. Erst als mit der Pleite von Lehman Brothers die flüssigen Mittel versiegten, standen die leichtsinnigen irischen Banken am Abgrund. Im September 2008 garantierte der irische Staat ihre sämtlichen Verbindlichkeiten (mit Ausnahme des Aktienkapitals). Das war die Ursünde. Der inzwischen verstorbene Finanzminister Brian Lenihan, ein kluger und ehrenwerter Mann, sagte am folgenden Tag, es könnte sich dabei um die billigste Bankenrettung der Weltgeschichte handeln. Die Geschichte ist grausam.
Mittlerweile ist das irische Bankensystem eine Trümmerlandschaft. Allied Irish Bank, die einst größte Bank des Landes, gehört inzwischen zu 99,8 Prozent dem Steuerzahler (Preis: 20,8 Milliarden Euro). Die beiden Casinos des „Wilden Westens am Liffey“ (so heißt der Fluss, der durch Dublin fließt), Anglo Irish Bank und Irish Nationwide Building Society, verschlangen fast 35 Milliarden und werden inzwischen in der Auffanggesellschaft Irish Bank Resolution Corporation (IBRC) abgewickelt. Dank eines buchhalterischen Tricks resultierten die 4,7 Milliarden, die in die Bank of Ireland flossen, nur in einem Staatsanteil von 15 Prozent. Der Börsenwert des Hauses liegt weit unter der gesamten Staatseinlage. Von den Husaren des Booms ist nichts mehr übrig geblieben.
Aber das ist nicht alles: Die kommerziellen Immobilienkredite (Bürogebäude, Hotels und die erwähnten matschigen Wiesen in der Grafschaft Offaly) der irischen Banken waren derart morsch, dass selbst die frühere irische Regierung radikal wurde: Nama wurde erfunden, die National Assets Management Agency. Nama ist eine staatliche toxische Bank, die sämtliche kommerziellen Immobilienkredite der irischen Banken aufkaufte; ein weiterer Trick bewirkte, dass ihre Verbindlichkeiten nicht in der Staatsschuld erscheinen. Für einen Buchwert von 74 Milliarden zahlte sie 31, mithin ein Abschlag von 58 Prozent. Die Spanier versuchen derzeit Ähnliches.
Nama erfasste allerdings bloß die sechs einheimischen irischen Banken. Wer dieser Tage die Bilanzen der verstaatlichten Royal Bank of Scotland, von Lloyds oder Rabobank und Danske Bank anschaut, wird mit Erstaunen feststellen, welche Unsummen hier jährlich abgeschrieben werden. Alle zockten mit. Lloyds Banking Group verkaufte dieser Tage das Immobilienportefeuille ihrer irischen Tochter Bank of Scotland (Ireland) mit einem Abschlag von 90 Prozent. Die einheimischen irischen Banken haben 2011 ihre Bilanzsummen um 40 Milliarden gesenkt; der Prozess dauert an. Die Abhängigkeit von der EZB und der irischen Zentralbank für die Liquidität der irischen Banken hat sich seit dem Höhepunkt im Frühjahr 2011 um ein Drittel auf rund 100 Milliarden verringert. Aber das ist immer noch ein wirksamer Hebel.
Teure Casinos
Was aber die duldsamen Iren auf die Palme treibt: Jede fällige Obligation des Casinos Anglo wurde vollumfänglich zurückgezahlt. Zu 100 Prozent. Das entsprach den unwiderstehlichen Wünschen der EZB. Als ob ein Diskont bei einer abgewickelten irischen Nischenbank das europäische Bankensystem gefährden könnte! Aber als Irland im Dezember 2010 unter die Fittiche der Troika (IWF, EU, EZB) schlüpfte, waren die irischen Banken verantwortlich. Seither finanziert die Troika die Finanzbedürfnisse des irischen Fiskus, aber das Bankendebakel wurde ausschließlich von Irland bezahlt. Der Fonds für die künftigen Renten des Staatspersonals ist seither nur noch ein Schatten seiner selbst. Das Sparschwein wurde geschlachtet.
Gewiss. Die Iren, die aus historischen Gründen Immobilieneigentum in einer irrationalen Weise vergöttern, haben grandiosen Mist gebaut. Die Voraussetzung dafür allerdings war der Euro, der diesem Land in anderer Weise – wie bei der Ansiedlung von Multis – unendlich hilft. Aber als die Zinssätze 1999 in den Keller sanken, liehen deutsche, französische und britische Banken Unsummen an inkompetente, korrupte irische Banken. Diese Kreditgeber wurden und werden vollumfänglich entschädigt, weil es die EZB so wünscht. Irland hat seit 2008 einiges zur Stabilität des europäischen Bankensystems beigetragen.
Am 29. Juni 2012 beschloss der Europäische Rat, „den Teufelskreis zwischen Bankschulden und staatlichen Schulden zu durchbrechen“. Es ging damals um den desolaten Zustand der spanischen Banken, aber Irland wurde ausdrücklich erwähnt. In der Zwischenzeit hat Angela Merkel interveniert, nachdem ihr Finanzminister Schäuble zusammen mit seinen niederländischen und finnischen Kollegen festgestellt hatte, diese Aussage sei niemals rückwirkend zu verstehen. Merkel versicherte den Iren, sie seien ein Sonderfall. Worum geht es?
Als Anglo (das Casino) rekapitalisiert werden musste, hatte der irische Staat nicht genügend Geld. Deshalb erhielt die Bank eine Schuldverschreibung des irischen Staates im Nominalwert von 31 Milliarden Euro. Die EU-Kommission bestand auf einem „marktgerechten“ Zinssatz von über 8 Prozent. Das bedeutet, dass die Abwicklung der beiden Casinos den irischen Steuerzahler 51,4 Milliarden Euro kostet – bis 2031. Die EZB weigert sich bis heute, die Fristigkeit zu verlängern und den Zinssatz zu verringern. Obwohl das Geld des Steuerzahlers (3,1 Milliarden per 31. März 2013; im Budget für 2013 ist der Zinsanteil von 1,9 Milliarden erfasst) endgültig bei der irischen Zentralbank landet und dort verbrannt wird.
Ferner könnten der ESFS oder der ESM – oder irgendwer – die staatlichen Anteile an den existierenden irischen Banken übernehmen. Aber das wird von zahlreichen deutschen Politikern vehement abgelehnt, obwohl es durchaus lukrativ sein könnte.
Das ökonomische Irland ist ein Land der Extreme. Derzeit wandert 1 Prozent der einheimischen Bevölkerung aus. Die ausländische Bevölkerung nahm zwischen 2002 und 2011 um 143 Prozent zu. Am Anfang dieser Periode gab es 2124 Polen in Irland. Am Ende waren es 122 585. Spannungen sind selten.
Fazit: Seit dem Höhepunkt des Irrsinns sind rund 360 000 Arbeitsplätze in Irland vernichtet worden; das ist etwas weniger als ein Fünftel. Im Bausektor beträgt der Abbau 64 Prozent – es gibt 16 881 leere Häuser und 7992 Wohnhäuser, die „fast fertig“ sind. Die irische Wirtschaftsleistung ist um 11 Prozent gesunken (das wäre das Bruttoinlandsprodukt; das relevantere Bruttosozialprodukt sank um 14,6 Prozent). Gleichzeitig hat das konservative Irland das progressivste Steuersystem der EU und die höchste Geburtenrate.
Deutschland, als Zahlmeister der EU, hält das Schicksal Irlands in seinen Händen. Ist das ein Hilferuf? – Ja. – Wie sagte Erich Kästner? Was auch immer geschieht: Nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Dr. Martin Alioth ist IrlandKorrespondent u.a. für den Schweizer Rundfunk SRF, die Neue Zürcher Zeitung, den Standard und den ORF.
Internationale Politik 1, Januar/ Februar 2013, Seite 76-81