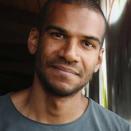Am Ende in Mali
Nach zehn Jahren bereitet sich die Bundeswehr auf den Ausstieg aus der MINUSMA- Mission und den Abzug aus Mali vor, unverrichteter Dinge. Stabiler ist das von Terroristen bedrohte Land nicht geworden. Die Geschichte einer unmöglichen Mission.
Die Nachmittagssonne brennt auf Haoussa Foulane hernieder, auf ein Dorf im Norden Malis, aus dem vor allem schlechte Nachrichten kommen. Ein deutscher Soldat marschiert die sandigen Straßen entlang. Er trägt eine tarnfarbene Schirmmütze, Sonnenbrille. Sein Sturmgewehr baumelt, befestigt an der kugelsicheren Weste, vor seiner Brust. Im Schatten einer Mauer haben Bewohner Haoussa Foulanes Schutz vor der Hitze gefunden. Auf Teppichen liegen sie da, plaudern. „Ich bin Hector, ich bin der Führer vor Ort“, unterbricht der Soldat und zeigt auf die Kameraden, die ihm folgen. „Wer seid ihr?“ Ein Mann in einem blauen Boubou, einem traditionellen, bodenlangen Gewand, ergreift das Wort. Und er hält sich nicht lange mit Smalltalk auf. „Die Terroristen und Banditen haben keine Angst vor euren Patrouillen“, sagt er. „Wenn ihr auf einer Seite des Dorfes mit uns sprecht, rauben sie uns auf der anderen Seite aus. Uns hilft hier niemand.“
Hector führt an diesem Nachmittag Ende März einen leichten Spähzug der Bundeswehr durch Haoussa Foulane. Er und seine Kameraden sammeln Informationen, um das Lagebild zu verbessern, wie es im Militärsprech heißt. Aussagen wie die des Mannes im blauen Boubou sind immer öfter zu hören. Keine Hilfe? Ist das die Bilanz? Die abschließende Bilanz des Einsatzes der Bundeswehr in Mali?
Seit Jahren beteiligen sich die deutschen Streitkräfte nun schon an der Mission MINUSMA, der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in dem Land. Im Mai wird die Bundesregierung dem Bundestag ein letztes Mandat für den Einsatz vorlegen. Damit soll der Abzug eingeläutet werden, ein Jahr später der letzte deutsche Soldat das Land verlassen. Doch das Ziel der Mission, Stabilität, ist kaum greifbar.
Der Aufstand der Touareg
Der Anlass für den Einsatz reicht elf Jahre zurück. Die Tuareg-Stämme im Norden des Landes fühlen sich seit eh und je von der Zentralregierung in der fernen Hauptstadt Bamako ausgegrenzt. Sie träumen von einem eigenen Staat namens Azawad, einer historischen Region im Norden Malis. 2012 entstand eine bewaffnete Rebellion, die von der MNLA angeführt wurde, der Nationalen Bewegung für die Befreiung des Azawad. Die Verteidigungslinien der schlecht ausgestatteten und ausgebildeten malischen Armee brachen schnell. Die Tuareg-Rebellen nahmen eine Stadt nach der anderen ein. Allerdings dauerte es nicht lange, bis dschihadistische Kräfte in ihren Reihen die Rebellion kaperten. Es waren Verbündete von Al-Kaida. Sie setzten die Scharia durch und rückten immer weiter vor. Bald drohten sie, nicht nur das Territorium Azawads, sondern das ganze Land zu erobern.
Auf Bitten der damaligen Staatsführung griff die frühere Kolonialmacht Frankreich ein, verjagte die Aufständischen mit Panzerwagen und Kampfhubschraubern aus den Städten. Die Kämpfer tauchten in der Bevölkerung unter oder versteckten sich in der Wüste. 2013 folgte jene Operation der UN, für die nun auch der Soldat Hector im Einsatz ist. Die Mission wurde MINUSMA getauft, kurz für „Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali“. Das Ziel war, die Wiederherstellung der staatlichen Autorität im ganzen Land zu unterstützen und die Zivilbevölkerung vor Gewalt zu bewahren. Die Operation wuchs auf mehr als 10 000 Soldaten an. Die Bundeswehr beteiligte sich mit mehr als 1000. Mali ist heute, kurz vor dem Beginn des Abzugs, der größte Auslandseinsatz Deutschlands.
Die Tuareg-Rebellen ließen sich 2015 auf einen Friedensprozess mit der Regierung ein, ihre Waffen schwiegen. Die MINUSMA unterstützt diese Aussöhnung seither. Die Dschihadisten allerdings kämpften weiter und schnell breitete sich die Gewalt wieder aus. Der internationalen Gemeinschaft gelang es nur leidlich, die großen Städte im Norden zu halten.
Heute kontrollieren die Dschihadisten weitflächig ländliche Regionen und etablieren dort staatsähnliche Strukturen. Sie erheben den Zakat, eine religiöse Steuer. Neben einem Al-Kaida-Ableger ist auch eine Gruppe mit Verbindungen zum Islamischen Staat (IS) entstanden. Die Gewalt dieser Kräfte erfasste nicht nur den Norden Malis, sie breitete sich in das Zentrum des Landes aus, erreichte Burkina Faso und Niger; mittlerweile sorgen die Gruppen selbst am Golf von Guinea für Unruhe. Nach Angaben des Armed Conflict Location and Event Data Project war das Jahr 2022 mit fast 8000 Toten durch dschihadistische Gruppen das bisher tödlichste im Sahel. Wie konnte es trotz des gewaltigen Engagements der UN, Deutschlands, so weit kommen?
Hector hat sich zu den Bewohnern Haoussa Foulanes in den Schatten gesetzt. Der Mann im blauen Boubou mustert den kräftigen Deutschen, an dessen Kampfanzug neben dem Sturmgewehr auch eine Pistole baumelt. „Die Terroristen fahren hier auf ihren Mopeds herum und bedecken ihre Waffen nur mit einer Decke“, sagt der Bewohner des Dorfes. Niemand kontrolliere sie, nichts geschehe. Ein Kamerad Hectors macht Notizen, hält Details über die Bewegungsmuster der Terroristen fest. Hector nickt nur. Er verspricht keine Besserung.
Beim anschließenden Weitermarsch durch die sandigen Straßen Haoussa Foulanes erklärt Hector, dass es die Umsetzung des Mandats nicht zulasse, hier Checkpoints aufzustellen. Bei MINUSMA handelt es sich um eine sogenannte Peacekeeping-Mission. Hector und seine Männer sollen nur eingreifen, wenn Zivilisten oder die eigenen Kräfte attackiert werden. Hector spricht schnell, er wirkt gehetzt. Er will in diesem Moment nicht darüber reden. Neben Hector geht ein Presseoffizier, er achtet darauf, dass kein falsches Wort fällt. Das übliche Prozedere bei der Bundeswehr. Soldaten sollen nur über ihre Arbeit sprechen. Deren politische Dimensionen sind ausgeklammert, Fragen nach dem Sinn ebenso.
Vom deutschen Einsatzführungskommando heißt es schriftlich zu den Terroristen, die mit ihren Waffen unbeirrt an den UN-Patrouillen vorbeifahren: „Die Aufgabe der Bundeswehr ist es nicht, Durchsuchungen durchzuführen.“ Dass man Aufgaben der malischen Gendarmerie oder Armee übernehme, sei nicht vom Mandat gedeckt.
An der Hauptstraße warten gepanzerte Wagen, Typ Eagle. Es sind zehn Tonnen schwere Ungetüme, minensicher. Auf dem Dach ragt ein ferngesteuertes Maschinengewehr in den Himmel. Die Bundeswehr ist eigentlich gut ausgestattet für den Einsatz. Und gut trainiert.
Hector kam 1987 zur Welt, war schon als Junge abenteuerlustig. Selbstverwirklichung heiße für ihn, an seine persönlichen Leistungsgrenzen zu gehen, sagt er. Als er mit dem Fachabitur fertig war, meldete er sich zunächst wider Willen zum Wehrdienst. „Für meinen Vater hat es dazugehört, dass ein Mann dient.“ Schon während der Grundausbildung spürte Hector, dass die Bundeswehr ein Ort ist, an dem es viele Möglichkeiten für ihn gibt. Hector ist heute Fernspäher, ein Fallschirmspringer, der auch als Scharfschütze ausgebildet ist. Seine Missionen gelten als so exponiert, dass weder sein Bild noch sein richtiger Name für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Ein Selbstdarsteller ist er nicht. Nur zögerlich gibt er preis, dass er seit Ende März auch Rekordhalter der „Viking Challenge“ ist, eines Fitnesswettkampfs, den sich Soldaten in Mali ausgedacht haben. In 38 Minuten ist Hector einen 1000-Meter-Lauf gerannt, ist 1000 Meter gerudert, hat einen 15 Kilo schweren Sandsack 50 Mal über die eigene Schulter geworfen. 50 Pull-ups, 100 Liegestütze, zum Abschluss hat er dann noch 40 Kilo Gewicht über eine Strecke von 500 Metern gezerrt. „Ich bin in einer Einheit, die ziemlich cooles Zeugs macht“, sagt er. Zumindest im Training, und wenn es das Mandat erlaubt.
Im gepanzerten Eagle flimmert das Schussfeld des ferngesteuerten Maschinengewehrs auf einem Monitor, als es aus einem von Hectors Kameraden herausbricht. „Ich halte nichts von Peacekeeping“, sagt der Soldat. „Wenn man Männer mit Waffen schickt, sollten sie ihre Waffen auch einsetzen dürfen.“ Am späten Nachmittag kommt Hectors Spähzug in Gao an, der größten Stadt in der Region. Der Eagle durchquert ein Labyrinth aus Sandsäcken, auf denen Stacheldraht gespannt ist. Es geht durch eine Schleuse, die das Fahrzeug voll automatisiert nach Sprengfallen scannt. Camp Castor, die Basis der Bundeswehr. Es ist der wohl sicherste Ort im Norden Malis. Und doch ist der Feind nie weit. „Der IS kommt uns so nah, dass wir ihn anspucken könnten“, sagt der aufgebrachte Kamerad Hectors. „Wir haben ein viel zu schwaches Mandat. Die Terroristen tanzen uns auf der Nase herum.“
Die Späher der Dschihadisten
Nur ein paar hundert Meter vor Camp Castor, an einem Kreisverkehr, ist oft ein Späher der Terrorgruppen zu sehen. Er gibt die Bewegungen der UN-Kräfte durch. Und die dürfen nichts dagegen machen. Ein Mann, der zum Handy greift, wenn eine Patrouille vorbeirollt, ist keine direkte Bedrohung, darf weder festgenommen noch durchsucht werden. Die Terrorgruppen wissen meist, wo die Soldaten der Vereinten Nationen sind, und sie wissen genau, wo die Grenzen ihres Mandats liegen. Zu Beginn haben die Terroristen noch oft gezielt Camps, Konvois und Patrouillen der UN angegriffen. Die Mission ist mit rund 300 getöteten Blauhelmen eine der tödlichsten der internationalen Gemeinschaft. Doch mittlerweile wissen die Terrorgruppen, dass solche Anschläge nicht notwendig sind, um ihre Machtbasis auszubauen.
Ein paar Tage später sitzt Hector in einem Konferenzraum im Camp Castor. Die Klimaanlage surrt. Ein weißer Tisch, darauf steht kühles alkoholfreies Bier. Die wüstenartigen Landschaften Malis wirken plötzlich wie eine ferne Realität. Doch der Soldat erinnert sich an eine seiner Aufkläroperationen, die viel über diese Realität verrät. Hector und seine Kameraden stießen westlich von Gao auf einen 20-Jährigen mit einer Kalaschnikow, der sich in einem Busch versteckt hatte. Der junge Mann kam auf die Patrouille zu, sagte, dass er ein Mitglied des Al-Kaida-Ablegers JNIM sei und sich ergeben wolle. Er sei von den Terroristen gezwungen worden, mitzumachen. Hector und seine Kameraden befragten ihn, bis ein Funkspruch einging. „Nach circa 20 Minuten kam der Befehl von der übergeordneten Führung, dass wir ihn laufen lassen sollen“, erinnert sich Hector. Es gab keine Ermittlungen. Bis heute ist nicht klar, was aus dem Mitglied der Terrorgruppe geworden ist.
Die Erklärung des Einsatzführungskommandos lautet: „Die Teilnahme an Operationen zur Terrorismusbekämpfung ist nicht vom Auftrag erfasst.“ Festhalten dürften Bundeswehrsoldaten Verdächtige nur dann, wenn diese kurzfristig an die malischen Behörden übergeben werden können. Doch die malischen Behörden waren nicht in der Nähe. Mali ist ungefähr 1,2 Millionen Quadratkilometer groß, viermal so groß wie Deutschland. Dort sind in etwa so viele malische Soldaten im Einsatz wie es Polizisten in Berlin gibt.
Hector wippt mit seinem Fuß. Er könne nachvollziehen, dass die Menschen von MINUSMA enttäuscht seien, sagt er. „Ich versuche bestmöglich, meinen Auftrag durchzuführen, aber die Kräfte hier unterliegen nun mal Vorschriften der UN“, sagt er. „Mit unseren Fähigkeiten könnten wir viel mehr tun.“
Gerüchte und Vorwände
Für die meisten Malier geben die UN-Truppen ein bizarres Bild ab. Sie sehen das hochgerüstete Camp Castor, die gepanzerten Wagen und durchtrainierte Soldaten wie Hector. Dann fragen sie sich, was die überhaupt in Mali machen. Die Diskrepanz ist so gewaltig, dass Verschwörungsmythen aufkeimen. Laut einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2022 glaubt fast jeder dritte Malier, der mit MINUSMA unzufrieden ist, dass die Blauhelme mit bewaffneten Gruppen im Land paktierten. Oft ist auch zu hören, dass die Gewalt in Mali nur eskaliert, weil die Blauhelme den Terroristen einen Vorwand böten. Angesichts von Malis Kolonialgeschichte verfängt das Narrativ einer Besatzungsmacht, der es am Ende nur darum gehe, sich den Zugang zu Rohstoffen zu sichern.
Die Gründe für die Kluft zwischen Mandat und der malischen Realität sind vielschichtig. Die UN haben durchaus Lehren aus ihrer Geschichte der Friedensmissionen gezogen. Mitte der 1990er Jahre wurde Blauhelmen in Ruanda und im zerfallenden Jugoslawien vorgeworfen, im Angesicht eines Völkermords nicht eingegriffen zu haben. Bei MINUSMA ist dagegen völlig klar, dass die Blauhelme Gewalt anwenden dürfen, wenn die Zivilbevölkerung vor ihren Augen in Gefahr gerät. Nur reicht das offensichtlich nicht, wenn die malischen Sicherheitskräfte nicht ausreichend in der Lage sind, offensiv gegen die Terroristen vorzugehen.
Warum die Bundeswehr trotz dieser Lage kein robusteres Mandat hat, ist für Hector offensichtlich: „Wenn wir hier offensiver vorgehen, müssten wir damit rechnen, dass auch getötete Soldaten heimgeflogen werden“, sagt er. Für ihn und viele seiner Kameraden gehört das zum Berufsrisiko. „Wenn man sich dazu entschließt, die Bundeswehr in einen Auslandseinsatz zu schicken, sollte der Auftrag an erster Stelle stehen und nicht die Zahl der gefallenen Soldaten“, sagt er.
Doch auf politischer Ebene wird das anders gesehen. Frankreich war lange Zeit das einzige europäische Land, das bereit war, in Mali auf Terroristenjagd zu gehen. Bis zu 5000 Mann waren in der „Operation Barkhane“ aktiv. Mehr als 50 verloren ihr Leben. Eine Bilanz, die kaum ein anderer europäischer Staat riskieren wollte. Dabei wäre es vielen Maliern lieber gewesen, wenn Deutschland, nicht der einstige Kolonialherrscher Frankreich, die militärische Führungsrolle des internationalen Engagements übernommen hätte.
Ob ein offensiveres militärisches Vorgehen die Lage wirklich verbessert hätte, ist unklar. In Afghanistan hatten die Bundeswehr und andere Truppensteller der NATO ein deutlich robusteres Mandat. Das Land ist heute trotzdem in den Händen der Taliban. Doch mit Blick auf MINUSMA gilt: Das Mandat ist so ausgelegt, als würde jemand anderes, nämlich der malische Staat, offensiver vorgehen; nur geschieht das kaum. Und so wirkt die Mission wie völlig aus der Zeit gefallen. Wie staatliche Autorität wiederherstellen, wo es sie nie gab? Große Teile Malis waren schon vor dem Aufstand der Tuareg 2012 nicht unter staatlicher Kontrolle. Wie eine Sicherheit wahren, wo keine Sicherheit existiert? Nach der Intervention Frankreichs 2012 zogen sich die Terroristen nur zurück, verschwunden sind sie nicht. Was stabilisieren, wo Chaos herrscht? Mali war nie ein stabiler Staat. Auch wenn viele Truppensteller der UN so getan haben.
Lieber einen schlechten als gar keinen Partner?
Die deutsche Bundesregierung hat lange darauf gesetzt, die malischen Streitkräfte im Rahmen einer Ausbildungsmission der Europäischen Union (EUTM) aufzubauen. Sie sollten selbst für Sicherheit im Land sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützte Berlin den damaligen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta – einen nur vermeintlich stabilen Partner. Keïta zeigte nur wenig Ambitionen, das Land wirklich voranzubringen. Das spiegelte sich auch im schleppenden Aufbau der malischen Streitkräfte wider. Sein Sohn Karim Keïta, zeitweise Vorsitzender der Sicherheits- und Verteidigungskommission des Parlaments, feierte Partys auf Luxusyachten, als dschihadistische Gruppen die Gewalt vom Norden ins Zentrum Malis trugen. Berlin unterstützte die Keïta-Regierung trotzdem. Besser ein schlechter als kein Partner, so die Devise. Eine Fehlkalkulation.
2020 gingen Zehntausende Malier in Bamako auf die Straßen und protestierten gegen eine Regierung, die selbst mit der Unterstützung von mehr als 10 000 Blauhelmen nicht in der Lage war, ihre Bürger vor Gewalt zu schützen. Wenig später putschten unzufriedene Militärs um Oberst Assimi Goïta. Seither herrscht in Bamako eine Junta, die nicht mehr auf Europa und die Vereinten Nationen setzt, um die Krise zu bewältigen. Viele Bürger Malis halten das angesichts der Bilanz der Blauhelmmission für keinen großen Verlust.
Für Hector und seine Kameraden sind die ohnehin engen Grenzen des Machbaren seither noch enger geworden. Oberst Goïta schikaniert Truppensteller der MINUSMA deutschen Verteidigungspolitikern zufolge geradezu. Die Junta verweigert Deutschland immer wieder Überflugrechte. Die Bundeswehr kann deswegen seit Monaten ihre Drohnen nicht einsetzen, die essenziell für die Aufklärungsfähigkeiten der UN-Truppe sind. Auch der Lufttransport mit Hubschraubern und Flugzeugen ist massiv eingeschränkt.
Hectors alkoholfreies Bier ist bereits warm, als er darüber spricht, dass er mit Mali abschließen muss. Für den Soldaten geht es im Juni zurück in die Heimat. Er habe die Menschen dieses Landes bei seinen Aufkläroperationen ein wenig kennengelernt, sagt er. „Natürlich entsteht da Empathie.“ Doch zu Hause wartet seine Familie auf ihn, die ihn braucht. „Ich kann dann nicht mehr die ganze Zeit in die Nachrichten gucken, was gerade in Gao los ist“, sagt er. Neben Deutschland ziehen auch Großbritannien, Norwegen und Schweden ab. Frankreich hat die „Operation Barkhane“ bereits 2021 eingestellt.
Die Junta hat sich mit Russland und dessen Söldnergruppe Wagner einen neuen Partner gesucht. Ein Gegenentwurf zu den zahmen UN. Anders als die MINUSMA gehen die russischen Kräfte mit äußerster Härte vor. Mit noch ungewissem Ausgang. Seit dem Putsch hat sich die Zahl getöteter Zivilisten laut dem Africa Center for Strategic Studies nicht verringert, sondern mehr als verdoppelt. Dabei ist auch von Menschenrechtsverbrechen durch die malischen Streitkräfte und ihre russischen Partner die Rede. Offenbar legen sie nicht besonders viel Wert darauf, bei ihren Operationen zwischen Zivilisten und Terroristen zu unterscheiden.
Es ist vor allem das Auswärtige Amt, das trotzdem darauf pocht, sich nicht endgültig abzuwenden. Anfang 2024 soll in Mali gewählt werden. Die Junta hat versprochen, die Macht wieder in die Hände des Volkes zu legen. Es ist unklar, ob es dazu kommt. Doch es ist ein Hoffnungsschimmer. Auch die Entwicklungszusammenarbeit, die im Kampf gegen den Terror mindestens so wichtig ist wie der Einsatz von Soldaten, will die Bundesregierung fortsetzen. Dabei ist die UN-Operation bei genauerer Betrachtung wohl selbst das größte Entwicklungsprojekt des Landes. Die internationale Mission mit ihrer gewaltigen Logistik sorgt für bis zu 10 Prozent der malischen Wirtschaftskraft und beschert vielen Maliern einen Arbeitsplatz. Wie lange es dabei bleibt, wird sich womöglich schon im Sommer abzeichnen. Dann steht auch für die MINUSMA die Mandatsverlängerung an. Die Debatten über die Zukunft der Blauhelmmission fallen in eine Zeit, in der in Mali auch die letzten Sicherheiten schwinden.
Ein Wohnviertel in Gao. Camp Castor wirkt weit weg. Durch eine offene Tür fällt etwas Licht in einen halbdunklen Raum. Auf Kissen sitzt ein Mann mit weißem Turban, nur seine Augenpartie ist zu sehen. „Wir haben einen Friedensvertrag unterschrieben“, sagt Rhissa Ag Assayid. „Aber nichts, was wir vereinbart haben, funktioniert.“ Assayid ist ein führendes Mitglied der MNLA, jener Gruppe, die 2012 den Aufstand der Tuareg angeführt und Malis Sturz ins Chaos ausgelöst hat. „Das Friedensabkommen ist nicht tot“, sagt Assayid, „aber wir suspendieren es.“ Der Tuareg ist frustriert. „Alle unsere Hoffnungen wurden enttäuscht“, sagt er. Vom Engagement der internationalen Gemeinschaft, von der Regierung Keïtas, von der Junta. „Solange es keinen richtigen malischen Staat, keine richtige malische Regierung gibt, werden wir weiter von Azawad träumen.“
Gewalt sei keine Lösung, versichert Assayid. Und doch spricht er darüber, was geschehe, wenn die Regierung in Bamako wieder zum „Feind“ werde. „Wenn die Dschihadisten nicht gegen Azawad sind, werden wir sie nicht angreifen“, sagt Assayid. „Wenn die Regierung zum Feind wird, wird sie unser aller Feind.“ Hinter den wohlgewählten Worten blitzt eine düstere Erkenntnis auf: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die einstigen Tuareg-Rebellen und die Terroristen den malischen Staat bald wieder gemeinsam angreifen.
Internationale Politik 3, Mai/Juni 2023, S. 104-109
Teilen
Themen und Regionen
Artikel können Sie noch kostenlos lesen.
Die Internationale Politik steht für sorgfältig recherchierte, fundierte Analysen und Artikel. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Angebot interessieren. Drei Texte können Sie kostenlos lesen. Danach empfehlen wir Ihnen ein Abo der IP, im Print, per App und/oder Online, denn unabhängigen Qualitätsjournalismus kann es nicht umsonst geben.