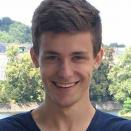Sehnsucht nach Wiederverzauberung
Gegen Liberalismus und Demokratie: Politische Theologie in den USA, Israel und Deutschland.
Es ist der Silvester-Abend im Polen des Jahres 1999. Anne Applebaum und ihre überwiegend bürgerlich-konservative Festgesellschaft blicken voller Optimismus auf das vor ihnen liegende Jahrhundert; die noch junge Niederlage des Kommunismus scheint auch der Sieg der liberalen Demokratie zu sein.
Doch gut 20 Jahre später geht ein Riss durch die Silvester-Gesellschaft von 1999: Manche unterstützen die seit 2015 in Polen regierende rechtspopulistische PiS, andere, zu denen Applebaum gehört, betrachten sie als Teil einer autoritären Revolte gegen die liberale Demokratie. Aus persönlichen und politischen Freunden sind Feinde geworden.
Dieser tiefe Riss, den Applebaum in ihrer jüngsten Buchveröffentlichung „Twilight of Democracy“ beschreibt, zieht sich nicht nur durch ihre damalige Silvester-Gesellschaft. Er beschränkt sich auch nicht auf die polnische Gesellschaft, sondern er ist ein Symptom eines in allen westlichen Gesellschaften erstarkenden Autoritarismus, der die liberale Demokratie und ihren Zusammenhalt auf die Probe stellt.
Anne Applebaum ist eine amerikanische Historikerin und Publizistin, die als Vertreterin der sogenannten „Neokonservativen“ galt, als der Konservatismus in den USA noch für einen amerikanischen Exzeptionalismus stand, der seine Errungenschaften – Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte – stolz in die Welt tragen wollte. In den 1990er Jahren schrieb sie für die einschlägigen neokonservativen Magazine wie den Spectator und den Weekly Standard und war Fellow am American Enterprise Institute, dem Flaggschiff der Neokonservativen. Als Architekten der verhassten „endlosen Kriege“ dienen die Neocons sowohl der amerikanischen Linken als auch der Rechten nach ihrer Hinwendung zum Isolationismus als Feindbilder. Und so ist es einsam geworden zumindest um jene Neokonservativen, die den Wandel des amerikanischen Konservatismus nicht selbst mitgemacht haben und deshalb heute oft zu den sogenannten „Never Trumpern“ der amerikanischen Rechten zählen.
Mit der persönlichen Anekdote vom Silvester-Abend 1999 erfasst Applebaum, die die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, viele Jahre in Polen gelebt hat und Expertin für osteuropäische Geschichte ist, ein neues politisches Klima, in dem nicht mehr wie gewohnt Argumente ausgetauscht werden und in liberaldemokratischer Tradition ein Konsens angestrebt wird, sondern der politische Gegner nur noch als existenzieller Feind begriffen und entsprechend bekämpft wird. Über Polen reist sie in „Twilight of Democracy“ weiter nach Ungarn, ins Vereinigte Königreich und in die USA.
Trotz ihrer so unterschiedlichen Geschichte, Kultur und politischen Systeme erkennt Applebaum in allen vier Ländern verblüffend ähnliche und zeitlich parallel auftretende rechtsautoritäre Bewegungen. In Polen arbeitet die PiS seit 2015 an der Aushöhlung des Rechtsstaats, in Ungarn wickelt die Fidesz-Regierung seit 2010 Minderheitenrechte ab, in Großbritannien wurde 2016 der Austritt aus der Europäischen Union eingeleitet, und in den USA steht nach vierjähriger Präsidentschaft Donald Trumps das Prinzip der freien und fairen Wahlen zur Disposition.
Allen vier Fällen sei gemeinsam, so Applebaum, dass dem Aufstieg des Autoritarismus eine „mittelgroße Lüge“ zugrunde liege (in Polen beispielsweise die Verschwörungstheorien rund um den Flugzeugabsturz des ehemaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczyński, in den USA die Fiktion eines Wahlbetrugs bei den Präsidentschaftswahlen 2020) und dass er mit einer massiven gesellschaftlichen und politischen Polarisierung verbunden ist, die politische Verbündete, Freundeskreise und Familien auseinandergerissen hat.
Carl Schmitts antiliberale Sehnsucht
Die Ursache für die synchron auftretenden Tendenzen der Polarisierung in den demokratischen Gesellschaften sucht Applebaum in der „autoritären Prädisposition“ des Menschen. Danach fühlten sich Menschen zu autoritären Ideen hingezogen, weil sie von einer immer komplexer werdenden Welt überfordert seien. Sie suchten Einheit, weil sie Spaltung ablehnten.
Das erscheint zunächst paradox: Warum folgt man in dem Streben nach Einheit einer autoritären Idee, die eine klare Freund-Feind-Unterscheidung vornimmt und kaum Interesse an demokratischem Diskurs und Konsensfindung hat? Zur Auflösung dieses Paradoxons könnte Carl Schmitts Politische Theologie beitragen, an deren Terminologie und Begriff des Politischen die politischen Diskurse der Gegenwart westlicher Gesellschaften zumindest stark erinnern. Diese Diskurse gleichen immer häufiger dem „Diskurs“ von Fans verfeindeter Fußball-Mannschaften, deren einziges Ziel die Abqualifizierung des Gegners ist und deren Mitglieder sich die Realität so zurechtbiegen, dass sie die Zugehörigkeit zum eigenen Lager legitimiert.
Im Mai 1933 trat der Staatsrechtler Carl Schmitt der NSDAP bei, und so ist es wenig überraschend, dass sein Denken und Wirken getrieben war vom Kampf gegen Liberalismus und Demokratie. Seine Ablehnung der liberalen Demokratie ist in der Politischen Theologie begründet, nach der alle Begriffe der modernen Staatsrechtslehre auf säkularisierte Begriffe zurückzuführen seien, wie Schmitt in seinen „Vier Kapiteln zur Lehre der Souveränität“ von 1922 schreibt. Er kritisiert, dass der moderne Rechtsstaat mit „positivistischer Gleichgültigkeit gegen jede Metaphysik“ den theologischen Ursprung seiner Begriffe ignoriere.
Der zentrale Begriff ist dabei der des Ausnahmezustands, der seinen religiösen Ursprung im Begriff des Wunders habe. Wie das Wunder die Naturgesetze überwinde und durchbreche, so konstituiere der Ausnahmezustand einen Eingriff des Souveräns in die geltende Rechtsordnung. Daraus leitet Schmitt seine bekannte Setzung ab, dass souverän sei, wer über den Ausnahmezustand entscheide. Weil sich der liberaldemokratische Staat seiner theologischen Letztbegründung und insofern auch einem dezisionistischen Verständnis von Demokratie entziehe, verkommt er nach Schmitt zu einer funktionalistischen Hülle für bloße „Mehrheits- und Minderheitsmathematik“, wie er 1932 in „Legalität und Legitimität“ schreibt.
Als Alternative zu dieser ihres Inhalts beraubten Form von Demokratie schlägt Schmitt schon 1926 in „Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie“ einen Staat vor, der auf der substanziellen Gleichheit des Volkes beruhe und der alles Nicht-Identische notfalls „ausscheiden oder vernichten“ müsse. Übrig bleibe ein homogenes Volk, dessen „Wille durch Zuruf, durch acclamatio, durch selbstverständliches, unwidersprochenes Dasein“ mindestens genauso gut wie durch einen „statistischen Apparat“ festgestellt werden könne. Es verwundert nicht – klingt hier doch schon die Verachtung der Wahlen als zentrale Institution der liberalen Demokratie an –, dass Carl Schmitt schließlich 1934 in „Der Führer schützt das Recht“ in Hitler den „wahren Führer“ sieht, der den homogenen Volkswillen zu antizipieren vermöge.
Mit Carl Schmitt könnten die modernen autoritären Bewegungen zwar sekundär auch – wie von Applebaum vermutet – auf der Suche nach Einheit sein, sich aber primär nach einer „Wiederverzauberung der Politik“ sehnen, das heißt nach einer in der Metaphysik liegenden Letztbegründung von Herrschaft, die der liberalen Demokratie fehlt, die als technisch-bürokratische und reiner Arithmetik folgende Herrschaft wahrgenommen wird. Anhaltspunkte für solch eine antiliberale Sehnsucht lassen sich trotz ihrer Unterschiedlichkeit in den politischen Systemen der USA, Israels und Deutschlands finden. Gleichzeitig haben diese drei Systeme ihre je eigenen Abwehrmechanismen zur Verteidigung ihres Rechtsstaats und ihrer Demokratie.
„The Big Lie“: Probe des Ausnahmezustands
Die Kongressabgeordnete Liz Cheney gilt oder galt bislang nicht als eine besonders moderate Republikanerin. In allen „partisan issues“, seien es Fiskal-, Grenz- oder Außenpolitik, vertritt Cheney ausweislich ihres Abstimmungsverhaltens konsequent konservative, traditionell republikanische Positionen. Dennoch ist sie für die Mehrheit der republikanischen Parteibasis, die Ex-Präsident Trump treu ergeben ist, ein „RINO“, ein „Republican In Name Only“. Als „RINO“ gelten für diese Parteibasis inzwischen alle, die sich weigern, „The Big Lie“ – die große Lüge vom Wahlbetrug bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 zugunsten des gewählten Präsidenten Joe Biden – zu glauben und öffentlich zu verbreiten.
Liz Cheney, die im Repräsentantenhaus die einzige Abgeordnete für den konservativen Bundesstaat Wyoming ist, war im Januar 2021 eine der wenigen republikanischen Abgeordneten, die für das Impeachment gegen den damaligen Präsidenten Trump stimmten. Seither spricht sie sich regelmäßig öffentlich gegen die Verschwörungsmythen rund um die Präsidentschaftswahl und für demokratische und rechtsstaatliche Grundprinzipien aus. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl ist für die Republikanische Partei mittlerweile zu einem derart identitären Thema geworden, dass Cheney für ihre Abweichung von der Parteilinie im Mai aus der Fraktionsführung der Republikaner im Repräsentantenhaus hinausgewählt wurde. Stattdessen wurde sie im Juli von der Demokratin Nancy Pelosi zum Mitglied des überparteilichen Komitees ernannt, das den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar aufarbeiten soll.
Am Fall Cheney und „The Big Lie“ zeigt sich zweierlei: Zum einen wird offenbar, wie der Mainstream der Republikanischen Partei bewusst Misstrauen im demokratischen Prozess des liberalen Rechtsstaats schürt. Zum anderen wird deutlich, wie konsequent die Partei Abweichler in dieser Frage bestraft und darauf bedacht ist, ideologische Homogenität in den eigenen Reihen herzustellen.
In der Fiktion eines Wahlbetrugs und in der Delegitimierung der US-Präsidentschaftswahlen 2020 werden einige Komponenten der Politischen Theologie Carl Schmitts sichtbar. So ist der Angriff auf freie Wahlen an sich bereits ein antiliberaler Akt, und auch die Erzählung hinter „The Big Lie“ erinnert auffällig an Schmitts Aversion gegen den Parlamentarismus: Der angebliche Wahlbetrug wird als das Werk einer abgehobenen Washingtoner Elite inszeniert, die die Wahl Trumps, den Kandidaten der „silent majority“, mit allen Mitteln zu verhindern suchte. Bei Schmitt klingt das noch so: „Heute erscheint das Parlament eher selbst als eine riesige Antichambre vor den Bureaus oder Ausschüssen unsichtbarer Machthaber.“
Der Aufstand gegen die „unsichtbaren Machthaber“ wurde vorerst im Januar beim Sturm auf das Kapitol geprobt. Die Institutionen des liberalen Rechtsstaats hielten stand und stellten eine Übergabe der Macht an den Gewinner der demokratischen Wahl, Joe Biden, sicher. Und doch kann die weiterhin vorgetragene „Big Lie“, dass Trump noch immer der rechtmäßige Präsident der USA sei, als eine Probe des Ausnahmezustands gelten, die die Frage nach der Souveränität stellt.
Während die liberale Demokratie sich nur prozedural etwa mit freien Wahlen rechtfertigen kann, sucht der Autoritarismus seine Rechtfertigung in der Metaphysik und in einem homogenen Volkswillen. Nur so ist nachvollziehbar, dass Anhänger Trumps und wohl sogar Trump selbst die Regeln des Verfassungsstaats gänzlich außer Acht lassen und davon überzeugt sind, dass der Ex-Präsident am Tag X wieder eingesetzt wird (das zuletzt kursierende Datum für das „reinstatement“ war der August 2021). Behielten sie recht, wäre es in der Tat ein Wunder, das die ultimative Letztbegründung für einen antiliberalen Staat im Sinne Carl Schmitts liefern würde. Geschieht kein Wunder, hat die liberale Demokratie in den USA vorerst gewonnen, aber falsifizierte Prophezeiungen haben auf Gläubige in der Regel nicht den erwarteten Effekt.
Die Alternative zum Autoritarismus
Auch wenn in Deutschland gerne so getan wird, als sei die Verlockung des Autoritären ein vor allem amerikanisches Phänomen, und es manchmal scheint, als schwinge bei den mit markigen Worten vorgetragenen Abgesängen auf die amerikanische Demokratie eine gute Portion Schadenfreude mit, sitzt in der Bundesrepublik mit der AfD eine rechtsautoritäre Partei seit vier Jahren im Bundestag. Spätestens mit dem Einzug der AfD ins Parlament etablierte sich auch ein neuer, verschärfter Ton, der zuletzt im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 sichtbar wurde.
Auffällig ist dabei, dass der Vorwurf selbst, sich polarisierender Rhetorik zu bedienen, zu einem zentralen Gegenstand der politischen Debatte geworden ist, und dass dieser Vorwurf kaum ohne einen Verweis auf die USA auskommt. In der Diskussion um Plagiate in ihrem Buch insinuierte die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gegenüber der Brigitte, dass die Plagiatsvorwürfe eine „Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit“ seien, wie man sie aus den USA kenne. Im Gegenzug schrieb die Neue Zürcher Zeitung in Reaktion auf die harte Verteidigungslinie der Grünen, dass die Grünen in den „Trump-Modus“ verfielen.
Die polarisierten deutschen Debatten der vergangenen Jahre drehten sich meist um identitätspolitische Themen wie Migration, Islam oder auch das Gendern. Und während die autoritäre Rechte auf diese Fragen ihre bekannten rechtspopulistischen, xenophoben, sexistischen und völkischen Antworten gab, hat sich auf der Gegenseite eine autoritäre Attitüde entwickelt, mit der jede Abweichung vom eigenen moralischen Standard unmittelbar abgestraft wird. Wer seine Sprache nicht gendert oder eine aufklärerische Islamkritik formuliert, gilt schnell als Rechtsaußen und hat sich für den Diskurs der Anständigen disqualifiziert.
Es scheint, als versuchten Teile der politischen Linken, auf die Sehnsucht der Rechten nach Wiederverzauberung der Politik im Sinne einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft mit einer Sehnsucht nach einer moralisch homogenen Gesellschaft zu antworten. Letztere ist zwar sympathischer als erstere, allein weil ihr der völkische Beigeschmack abgeht, aber die Rettung der liberalen Demokratie vor der autoritären Versuchung kann sie nicht sein.
Im linken Diskurs der Bundesrepublik gibt es jedoch Stimmen, die diese Leerstellen reflektieren und ungeachtet der politischen Konsequenzen Stellung gegen eine Mehrheit im eigenen Lager beziehen. Zu nennen sind hier Cem Özdemir, der seit Jahren trotz teils heftigen Gegenwinds aus den eigenen Reihen eine klare Haltung gegen jede Form des Antisemitismus und für Israel vertritt, oder Kevin Kühnert, der 2020 eine Debatte innerhalb der politischen Linken über ihre Haltung zum Islamismus anstieß. Nur mit einem solchen offenen demokratischen Diskurs lässt sich dem erstarkenden Autoritarismus etwas entgegensetzen.
Denn wenn ein sich auf Carl Schmitt beziehender rechter Autoritarismus gegen einen sich auf Chantal Mouffe und Ernesto Laclau beziehenden linken Autoritarismus antritt, hat die liberale Demokratie schon verloren. Statt den politischen Gegner moralisch zu delegitimieren, gilt es, die Prinzipien der liberalen Demokratie und der Freiheit zu verteidigen und trotz politischer Differenzen das Gemeinsame zu suchen.
Vereint gegen „Bibi“
Die politischen Rahmenbedingungen in Israel sind gänzlich andere als in den USA oder Deutschland: So ist Israel statt eines präsidentiellen Zweiparteiensystems wie in den USA eine parlamentarische Demokratie, in der sich mittlerweile, anders als in Deutschland, ein Parteiensystem mit ausgesprochen vielen Parteien herausgebildet hat. Bei der jüngsten Parlamentswahl wurden 13 verschiedene Listen in die Knesset gewählt, die viele verschiedene ideologisch oder demografisch eingrenzbare Interessen vertreten. Dementsprechend erschien es unwahrscheinlich, dass es in Israel zu einer Polarisierung in zwei sich feindlich gegenüberstehende Lager kommen kann. Und doch ist genau das passiert, wenn auch nicht entlang einer ideologischen Konfliktlinie, sondern entlang der Haltung zum langjährigen Premierminister Benjamin Netanjahu.
Obwohl die Parteien, die nominell rechts der politischen Mitte zu verorten sind, zusammen mit 72 von 120 Sitzen eine komfortable Mehrheit erreichten, konnte Netanjahu, der sich als Anführer dieses rechten Blockes versteht, keine Regierung bilden. Gleich drei Parteien des rechten Lagers – die nationalreligiöse Yamina von Naftali Bennett und Ayelet Shaked, die säkular-nationalistische Yisrael Beiteinu von Avigdor Lieberman und die Likud-Ausgründung Tikva Chadasha von Gideon Sa’ar – weigerten sich, in eine Koalition mit Netanjahu einzutreten. Ganz überwiegend hat dies weniger mit ideologischen Problemen als vielmehr mit persönlichen Vorbehalten gegen die Person Netanjahu zu tun. Sowohl Bennett und Shaked als auch Lieberman und Sa’ar tragen ihre je eigene Privatfehde mit dem langjährigen Premierminister aus, dessen Verbündete sie alle einst waren.
Statt also eine Koalition des rechten Blockes mit Netanjahus Likud zu bilden, gingen die drei Parteien ein Bündnis mit den Parteien des Zentrums und des linken Flügels ein. Um die knappe Mehrheit zu sichern, war es überdies notwendig, die islamistische Ra’am-Partei einzubeziehen. Und so wählte zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine arabische Partei als Teil einer Regierungskoalition einen Premierminister, in diesem Fall den als rechter Hardliner geltenden Bennett, der nach zwei Jahren im Amt vom liberalen Yair Lapid abgelöst werden soll.
Netanjahu reagierte entsprechend brüskiert, nannte die Koalition eine „gefährliche Koalition des linken Flügels“ und warf insbesondere den beteiligten Parteien des rechten Spektrums vor, israelische Interessen an Linksradikale und die arabische Minderheit verkauft zu haben. Tagelang wurde der Privatwohnsitz von Bennett und Shaked von wütenden Anhängern Netanjahus belagert. Die politische Rhetorik zwischen Pro- und Anti-Netanjahu-Block ist nur noch schwerlich als demokratischer Wettstreit um die besten Argumente zu erkennen, sondern erinnert, wie in den USA und in Carl Schmitts Begriff des Politischen, an eine existenzielle Auseinandersetzung zwischen zutiefst verfeindeten Lagern.
Yoaz Mendel, ebenfalls ein ehemaliger Weggefährte Netanjahus und Kommunikationsminister der neuen Regierung für Tikva Chadasha, erklärt die bemerkenswerte politische Komposition der neuen Regierung so: „Being right-wing does not mean being a Bibi-ist.“ Und doch erstaunt es, dass das Einende der Opposition zur Person Netanjahu offenbar stärker war als die zweifellos riesigen ideologischen Differenzen zwischen den Koalitionsparteien.
Carl Schmitt hätte es sicherlich nicht gefallen, dass der Kandidat einer Partei, die gut 6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, in bester liberaldemokratischer Manier einen Konsens mit sieben anderen Parteien erzielte, um sich eine knappe Mehrheit in der Knesset zu sichern und sich zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen.
Für ihn wäre es der Exzess bloßer „Mehrheits- und Minderheitsmathematik“, das endgültige Verkommen der Demokratie zur funktionalistischen Hülle, in der Politiker machtpolitische und pragmatische Bündnisse eingehen und den „Volkswillen“ scheinbar völlig ignorieren. Tatsächlich jedoch ist die israelische Regierungsbildung ein Sieg der liberalen Demokratie und ein Zeichen ihrer Vitalität. Denn ohne die Fähigkeit, gegenläufige Interessen auszubalancieren und einen Konsens herbeizuführen, kann die liberale Demokratie nicht überleben.
Jakob Flemming arbeitet nach seinem Masterabschluss im Studiengang Internationale Politik und Internationales Recht an der Universität Kiel aktuell als Politikberater in Berlin. Ein besonderes Interesse für die deutsch-israelisch-amerikanischen Beziehungen begleitete seine universitäre Laufbahn: Im Bachelor studierte er Politische Wissenschaft und Jüdische Studien an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, während seines einjährigen Studienaufenthalts an der University of Kansas forschte er zum Wählerverhalten bei den Knesset-Wahlen. In seiner Masterarbeit untersuchte er Determinanten des außenpolitischen Abstimmungsverhaltens von Abgeordneten des US-Kongresses. Ehrenamtlich engagiert er sich für das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und die Initiative junger Transatlantiker.
Internationale Politik Special 7, November 2021, S. 66-73