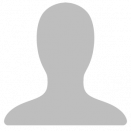Pflicht zum Verzicht
Zuckerbrot und Peitsche: Wie man mit potentiellen Atommächten umgeht
Was kann die internationale Staatengemeinschaft tun, um die nukleare Aufrüstung autoritärer oder totalitärer Regime zu verhindern? Die Beispiele Nordkorea und Iran zeigen deutlich: Sinnvoller als ein militärisches Eingreifen ist die Förderung eines längerfristigen, evolutionären Regimewechsels.
Staatlich verordnete oder geduldete massive Verletzungen der Menschenrechte der eigenen Bürger durch Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit können die internationale Sicherheit bedrohen. Diese Ansicht hat sich in der internationalen Debatte seit mehr als einem Jahrzehnt etabliert, wenn auch selektiv umgesetzt – mit weitreichenden Folgen. Denn hieraus erwächst moralisch verantwortlichen – und/oder rechtlich mandatierten – Staaten das Recht, die innere und äußere Souveränität eines „devianten Regimes“ zu verletzen. Als „deviantes Regime“ wird dabei ein autoritäres oder totalitäres Regime verstanden, das in seinem Innen- und Außenverhalten von internationalen Rechtsnormen abweicht. Die Souveränitätsnorm wird verwirkt, wenn der souveräne Staat die Wohlfahrts- und Sicherheitsinteressen der eigenen Bürger verletzt. Die nachhaltige Weigerung eines Staates, das Wohlergehen seiner Bürger zu bewahren, stellt somit einen gerechten Grund für eine Intervention dar.
Die nukleare Provokation durch Nordkorea und den Iran sollte – auch hinsichtlich des Modellcharakters für andere nukleare Schwellenländer – zu einer nüchternen Debatte darüber anregen, inwieweit nicht auch die Aneignung von nuklearen Waffen und deren Trägermitteln einen gerechten Grund zur Intervention darstellt. Nicht nur die „responsibility to protect“ in Bezug auf Grund- und Menschenrechte wäre als zentrale Völkerrechtsnorm einzurichten, sondern auch die „responsibility to deny“ im Falle einer Aneignung und möglichen Weitergabe nuklearer Waffen.
Wenn deviante Regime nachweislich an einer nuklearen Waffenoption arbeiten oder über ein Arsenal an nuklearen Waffen verfügen, sollten diese Regime in ihrer souveränen Existenz massiv beschnitten und internationalem Druck ausgesetzt werden. Dieses Konzept der legitimen „Entmachtung“ devianter Regime, die ihre Souveränität durch die Entwicklung von Nuklearwaffen und deren Trägermitteln verwirken, wäre aber nicht nur als Recht, sondern – zumindest auf der normativen, wenn auch unwahrscheinlich auf der operativen Ebene – geradezu als universelle Pflicht zur Intervention anzusehen. Wenn die Aneignung einer militärischen Nuklearkapazität zum allseits anerkannten Bedingungsgrund legitimer externer Intervention wird, kann die bislang geltende Deutung des Besitzes dieser Waffen als Instrument zur Existenzsicherung sowie als Verhandlungskapital nachhaltig in Frage gestellt werden. Nuklearwaffen würden somit – wie im Falle Libyens – als existenzielles Risiko und nicht als Garant von Souveränität wahrgenommen werden.
Zuckerbrot und Peitsche
Die „Verantwortung zur Untersagung“ ist keinesfalls eine rein militärische Verpflichtung. Ein devianter Staat, der ein Nukleararsenal erwirbt oder entwickelt, muss vorrangig durch eine anreizgeleitete Strategie oder durch eskalierende, aber intelligente Sanktionen zum Verzicht auf die nukleare Bewaffnung bewogen werden. Durch materielle, finanzielle und wirtschaftliche Hilfe könnte damit die Legitimität des Regimes gegenüber der eigenen Bevölkerung gestärkt und das Regime damit intern abgesichert werden. Sicherheits- und Nichtangriffs-garantien durch die regionalen Großmächte geben dem Regime eine externe Existenzgarantie. Wie Nordkoreas Bruch des Agreed Framework verdeutlicht, ist die zentrale Problematik dieser Strategie, dass ein deviantes Regime sie zum verdeckten Ausbau der Nuklearfähigkeit nutzen kann. Nicht zuletzt deshalb müssen Anreizstrukturen von Sanktionsdrohungen begleitet oder stufenweise von Sanktionsregimen ersetzt werden. Erst wenn durch Anreize keine Verhaltensänderung erzielt werden kann, muss als ultima ratio ein Wechsel des Regimes angestrebt werden. Eine Variante ist dabei die Unterstützung eines evolutionären Regimewechsels bei gleichzeitigen strikten Maßnahmen, mit denen eine horizontale Proliferation verhindert wird. Derartige Regime können langfristig geschwächt, ausgehöhlt und schließlich beseitigt werden. Geeignete Maßnahmen dafür sind die nachhaltige Stärkung internen Widerstands und die Durchbrechung der Informationshoheit mit extraterritorialen elektronischen Medien bei gleichzeitiger finanzieller und wirtschaftlicher Aushungerung der diktatorischen Führungseliten durch restriktive, aber intelligente Sanktionen. Diese Variante der langsamen Regimezersetzung kann aber scheitern. Die zeitintensive Aushöhlung kann trotz – legaler – Blockade und Isolation zudem fallweise nicht verhindern, dass nukleares Wissen ausgebaut und proliferiert wird. Auch steigt das Risiko, dass ein in die Agonie getriebenes Regime zu einem nuklearen Verzweiflungsschlag ausholen könnte. Zudem könnten restriktive Sanktionen zu hohen Humankosten führen.
Umstritten und äußerst sorgfältig abzuwägen ist schließlich die gewaltsame Intervention durch verantwortliche Staaten, die mehrere kritische Faktoren berücksichtigen muss. Grundsätzlich müssten derartige Interventionen an ein Mandat des UN-Sicherheitsrats gebunden werden, um Missbrauch zu vermeiden. Die Beugung dieses Interventionsgebots durch die Blockade einer der Vetomächte würde aber die Abschreckungsmacht dieses Gebots aushöhlen. Daher muss letztlich auch die nicht mandatierte Gewaltanwendung durch verantwortliche Staatenkoalitionen als legitim begriffen werden.
Aber auch wenn auf legaler oder legitimer Basis militärisch interveniert wird, ist das Ziel des Regimewechsels gegen die möglicherweise immensen Humankosten einer militärischen Intervention abzuwägen. Sollte eine „chirurgische Enthauptung“ des Regimes nicht möglich sein, muss im Fall massiver Bodenoperationen jedenfalls die Lage nach der Intervention bedacht werden. Die nach einem Gewalteinsatz erforderlichen Mittel zur Stabilisierung der Gesellschaft würden immense finanzielle und materielle Stabilisierungsleistungen erfordern und hätten ungesicherte Erfolgsaussichten. Darüber hinaus müssten die intervenierenden Staaten fähig sein, die Unterstützung dieser kostenintensiven Operationen in der eigenen Bevölkerung nachhaltig aufrechtzuerhalten. Und schließlich ist ein wie immer gearteter Regimewechsel kein Garant eines Verzichts auf die nukleare Option, da exogene Faktoren ein neues Regime ebenfalls wieder zur Aneignung einer Nuklearkapazität veranlassen könnten.
Der militärische Regimewechsel kann auch dann bereits zwingend werden, wenn die zeitintensive Verfolgung der ersten beiden Strategien die Chancen auf einen erfolgreichen Militärschlag drastisch vermindert. In jedem Fall aber muss die Abwägung der Interventionskosten und der Gewinne im Sinne der Nonproliferation eingehalten werden.
Eine weitere militärische Option wäre die Entwaffnung ohne Regimewechsel. Doch auch diese Variante ist risikobehaftet. Ein Angriff auf die militärischen Fähigkeiten könnte von einem devianten Regime als unmittelbare Existenzbedrohung erachtet werden, wodurch es zu einer dramatischen Eskalation kommen könnte. Zudem könnte ein Angriff aufgrund ungenauer Standortkenntnis zur Härtung der Anlagen oder zu massiven Kontaminationen führen. Auch bleibt trotz der Zerstörung nuklearer Anlagen das nukleare Wissen erhalten. Der Fortbestand des Regimes ermöglicht daher grundsätzlich eine neuerliche (und sogar beschleunigte) Aufrüstung. Somit erscheint der Angriff auf die nuklearen Fähigkeiten eines devianten Regimes als die wohl unbrauchbarste Option.
Alle vier diskutierten Optionen sind mögliche, legitime und zwingende Antworten verantwortlicher Staaten auf den unerträglichen Zustand nuklearer Bewaffnung devianter Staaten. Alle bergen Eskalationsrisiken und können scheitern, aber alle lehnen die Akzeptanz von zerstörerischen Waffen im Arsenal devianter Regime ab und verwehren diesen die Berufung auf staatliche Souveränität. Nukleare Schwellenstaaten müssen durch abgestufte Maßnahmen zur Beschneidung der Souveränität von dem Erwerb nuklearer Waffen abgehalten werden: Anreizgeleitete Verzichtsstrategien sind dabei immer das erste Mittel. Diese können schrittweise durch Sanktionsregime begleitet oder ersetzt werden.
Militärische Strategien, um Regime zu entwaffnen oder zu enthaupten, sind erst in einer dritten Eskalationsstufe zu erwägen, wenngleich sie auch vorher nicht explizit ausgeschlossen werden sollten. Die dritte Stufe ist die Schlüsselebene: Sollte der zu erwartende Nutzen einer Intervention mit militärischen Mitteln für die Proliferationssicherheit nicht ausreichend sein, um die zu erwartenden Humankosten einer möglichen militärischen Eskalation vertretbar scheinen zu lassen, kann die „Verantwortung zur Untersagung“ nicht militärisch umgesetzt werden. Fatal aber wäre es, wenn die verantwortlichen Staaten dann resignierend oder aus instrumentellen Gründen einen neuen Nuklearwaffenstaat akzeptieren würden – wie dies im Falle Indiens und Pakistans geschehen ist. Auch wenn die militärische Option nicht umsetzbar ist, Anreiz- und Sanktionsstrukturen zunächst wirkungslos bleiben, muss das Bekenntnis zum evolutiven Regimewechsel aufrechterhalten und operativ umgesetzt werden.
Die Hauptverantwortung für die Durchsetzung dieses Konzepts liegt natürlich bei den offiziellen Nuklearwaffenstaaten. Zugegeben: Da diese Staaten ihren im Nichtverbreitungsvertrag (NPT) kodifizierten Abrüstungsverpflichtungen nur begrenzt nachkommen, können sie nuklearen Verzicht von anderen Staaten nur unter Beugung eigener Verpflichtungsnormen einfordern. Das erscheint aber gegenüber der Normenverletzung durch nukleare Schwellenländer für die internationale Sicherheit zunächst nachrangig.
Beispiel Nordkorea
Die nordkoreanische Führung hat ihre nuklearen Rüstungsprogramme in den letzten Jahren radikal ausgebaut. Japan und Südkorea sind die verletzlichsten Akteure der durch eine Nuklearisierung Nordkoreas veränderten Sicherheitslage in Ostasien. Die USA drängen als deren Bündnispartner und aus eigenen Sicherheitsinteressen auf eine energische Gegenreaktion, da sie eine langfristige Gefährdung amerikanischer Küstenregionen im Westen, vor allem jedoch die kurz- und mittelfristigen Risiken der Proliferation an andere Staaten, aber auch an nichtstaatliche Akteure befürchten.
Das Arsenal an Gegenreaktionen durch die US-Regierung ist grundsätzlich breit gefächert. Das neokonservative Lager bietet einen normativ-ideologisch begründeten Regimewechsel an. Dieses Ziel wird zwar nicht offiziell verfolgt, aber als optimales Szenario angesehen. Ein militärisch erzwungener Regimewechsel von außen ist aber nicht zu erwarten: Die amerikanischen Streitkräfte sind in Afghanistan und im Irak gebunden; die verbliebenen militärischen Kräfte reichen für einen effektiven Feldzug nicht aus. Zudem ist das Vergeltungsarsenal Nordkoreas beträchtlich. Vor allem Südkorea und Japan müssten mit massiven Zerstörungen rechnen. Ein militärisches Eingreifen würde auch die von den USA gegen Nordkorea geschmiedete Koalition sprengen: Russland, die Volksrepublik China und Südkorea lehnen einen Waffengang entschieden ab. Präzisionsschläge zur Zerstörung der nuklearen Anlagen und des Raketenarsenals wären eine weitere militärische Verhaltensoption, die jedoch aus den bereits angeführten Gründen wenig Aussicht auf Umsetzung und Erfolg hat.
Das realistische Lager in Washington lehnt eine militärisch erzwungene Regimeänderung ab. Die konservative Fraktion möchte durch harte multilaterale Sanktionen den Zusammenbruch des Regimes erreichen, was jedoch weder in Südkorea noch in China Unterstützung findet. Beide Staaten fürchten die Implosion Nordkoreas wegen der massiven Flüchtlingsströme und der immensen finanziellen Kosten einer sozioökonomischen Stabilisierung Nordkoreas. Zudem befürchtet China ein Vorrücken von US-Streitkräften an die eigene Grenze. Das progressive realistische Lager betont daher, angesichts dieser Vorbehalte müsse das Ziel vielmehr darin bestehen, in multilateralem Zusammenwirken die Absichten und das Verhalten Nordkoreas zu ändern. Dies kann durch harte Sanktionen versucht werden, ist aber durch begleitende Verhandlungen vermutlich leichter zu erreichen.
Letztlich entschied man sich für durch gezielte Sanktionen abgestützte Verhandlungen als einzige realistische Option. Die UN-Resolution 1718 vom 14. Oktober 2006 etablierte ein deutlich härteres Sanktionsregime als die vorherige Resolution 1695. Doch dieses Sanktionsregime war nur begrenzt wirksam, weil China die Durchsuchung von nordkoreanischer Seefracht ablehnte und der Landweg für den nordkoreanischen Handel weitgehend offen blieb. Auch Südkorea konnte sich nicht gänzlich durchringen, die „Sonnenscheinpolitik“ – nunmehr „policy for peace and prosperity“ genannt – abzubrechen.
Durch Sanktionen abgestützte und erzwungene Verhandlungen sahen sich aber einer entscheidenden Frage ausgesetzt: Ist das Atomar- und Raketenarsenal für Nordkorea überhaupt verhandelbar? Ist Nordkorea tatsächlich bereit, seine atomare Rüstung im Tausch für umfassende Unterstützungs- und Hilfsleistungen sowie -Sicherheitsgarantien für seine innere Herrschaftsordnung aufzugeben? Oder sieht Nordkorea die nukleare Bewaffnung als dauerhaft unverzichtbare Existenzgarantie?
Wandel durch Verhandlung?
Hielte Nordkorea an der nuklearen Bewaffnung fest, wären Verhandlungen nutzlos. Letztlich bliebe dann nur die faktische (vorübergehende) Anerkennung Nordkoreas als Nuklearstaat bei gleichzeitiger Unterbindung der Proliferation nuklearer und Raketentechnologie an andere Staaten und nichtstaatliche Akteure sowie die Hoffnung auf einen evolutionären Regimewechsel. Neben der Förderung eines solchen Wechsels müssten dann die Verteidigungsleistung Südkoreas und Japans gestärkt und regionale Raketenabwehrsysteme beschleunigt ausgebaut werden. Wenn die nukleare Rüstung für das nordkoreanische Regime aber verhandelbar wäre, würden sich drei zentrale Fragen stellen: Die Frage nach den Anreizen für einen umfassenden Nuklearverzicht Nordkoreas, die nach der Vertrauensbildung und jene nach dem Verhandlungsformat.
Nordkorea zielte auf direkte Sicherheitsgarantien der USA ab, die jedoch nur zur Abgabe multilateraler Garantien bereit waren. Zudem verlangte Nordkorea umfassende Energie-, Wirtschafts- und Finanzhilfe zur inneren Stabilisierung. Für die USA und Japan aber waren diese Zusagen ohne eine umfassende, überprüfbare und irreversible Abrüstung des Raketen- und Nuklearprogramms und den Wiedereintritt Nordkoreas in den NPT undenkbar. Der Betrug Nordkoreas im Rahmen des Agreed Framework diente dabei als Warnung: Ein betrügerisches Regime ökonomisch zu unterstützen wäre ein verheerendes Ergebnis.
Letztlich war klar, dass die Formel wohl lauten müsste: „freeze, deliver and dismantle“. Nordkorea müsste sich verpflichten, seine Waffen- und Raketenprogramme nachweislich und überprüfbar einzufrieren, um die geforderten Gegenleistungen zu erhalten. Darauf müsste ein international kontrollierter und überwachter vollständiger Abrüstungsprozess erfolgen. Kritiker bezweifelten die grundsätz-liche Verhandlungsbereitschaft Nordkoreas. Dabei blieb aber oft unberücksichtigt, dass die nordkoreanische Führung ihr zentrales Ziel der Regimeabsicherung nicht aus den Augen verlieren durfte. Die nukleare Bewaffnung kann das Regime nach außen absichern, internationale Sanktionsregime als Bestrafung aber können das Regime durch die sozioökonomische Verwahrlosung mittelfristig von innen gefährden.
Eine weitere drängende Frage war die nach dem Verhandlungsformat. Nordkorea hielt an seiner Forderung nach direkten Gesprächen mit den USA fest. Das multilaterale Format blieb letztlich trotz der bilateralen Begegnungen zwischen den Vertretern der USA und Nordkoreas am Rande der Sechser-Gespräche ergebnisarm. Angesichts der Beharrlichkeit Pjöngjangs war daher eine Haltungsänderung der USA letztlich unabdingbar, um zumindest die Möglichkeit einer Verhandlungslösung auszuloten. Bilaterale Konsultationen des US-Emissärs Christopher Hill mit dem nordkoreanischen Diplomaten Kim Kye-gwan in Berlin ermöglichten das am 13. Februar 2007 in Peking erzielte Verhandlungsergebnis über den stufenweisen Beginn eines Lösungsprozesses der Nuklearfrage.
Dieses Abkommen sieht vor, dass Nordkorea innerhalb von 60 Tagen den Reaktor in Yongbyon herunterfährt und versiegelt. Nordkorea erhält nach erfolgter Verifikation dieser ersten Schritte im Gegenzug eine Lieferung von 50 000 Tonnen Schweröl. Daneben sollen sechs Arbeitsgruppen eingerichtet werden, in denen die zentralen offenen Fragen getrennt behandelt werden sollen. In einem zweiten Schritt wird von Nordkorea die vollständige Offenlegung aller Komponenten des Nuklearprogramms und deren Stilllegung verlangt.
Obwohl dieses Abkommen einen Schritt in Richtung des Zieles der Denuklearisierung darstellt, lassen Probleme in der ersten Phase bereits erkennen, dass ein Erfolg des Abkommens fraglich ist. So sind etwa das Beharren Nordkoreas auf den Transfer von Geldern von der Banco Delta Asia in Macao nach Nordkorea und das Scheitern der bilateralen Gespräche mit Japan über die Frage durch Nordkorea entführter Japaner symptomatisch für das starke Misstrauen, das zwischen Nordkorea, Japan und den USA herrscht. Dieses Vertrauensdefizit könnte insbesondere in der zweiten Phase des Abkommens zu erheblichen Problemen führen. Eine zentrale Frage ist hierbei, ob Nordkorea wirklich alle Komponenten des Nuklearprogramms offenlegt und danach deaktiviert, also nicht nur den ohnehin veralteten und daher verzichtbaren Nuklearkomplex in Yongbyon, sondern auch die vermutete Urananreicherung.
Auf der anderen Seite ist der Erfolg des Abkommens auch vom Vertrauen der USA in die Offenlegung Nordkoreas und die Verifikation durch die IAEA abhängig. Ein zu starkes Beharren auf Beweisen für ein nordkoreanisches Urananreicherungsprogramm könnte Nordkorea wiederum zum Ausstieg aus dem Abkommen bewegen. Jedenfalls lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Nordkorea wirklich zum Verzicht auf das Atomarsenal und militärische Nukleartechnologie bereit ist. Wenn die nukleare Bewaffnung Nordkoreas aufrechterhalten bliebe, würden nicht nur eine regionale Eskalation und massive nukleare Aufrüstung drohen, sondern auch eine erhebliche Belastung des NPT-Regimes. Die Entscheidung zur notfalls alle Optionen ausschöpfenden „responsibility to deny“ ist damit angemessen. Auf operativer Ebene wird – parallel zur nachhaltigen Unterbindung horizontaler Proliferation – nur der evolutionäre Re-gimewechsel als Option bleiben.
Beispiel Iran
Das nicht auszuschließende Streben des Iran nach einer militärischen Nuklearoption ist ein strategisches Sicherheitsrisiko im Nahen und Mittleren Osten. Grundsätzlich wird die Wahl der eingangs beschriebenen Strategien gegen deviante Regime mit einer nuklearen Schwellenoption wesentlich vom Zeitfaktor und von der Bewertung der Absichten bestimmt.
Im Fall des Iran ist der Zeitfaktor kein vorrangiges Argument. Nach den meisten Schätzungen ist das Land noch mindestens drei bis fünf Jahre von der Entwicklung eines nuklearen Sprengsatzes entfernt; der Bau eines nuklearen Sprengkopfs, der auf Trägermittel montiert werden kann, dauert noch sehr viel länger. Daraus leitet sich ab, dass für die internationale Staatenkoalition zwar Handlungs-, aber derzeit noch kein Eskalationsdruck besteht.
Wird die iranische Führung als rationaler kollektiver Akteur verstanden, ist der Einsatz nuklearer Waffen etwa gegen Israel oder Staaten des Golf-Kooperationsrats äußerst unwahrscheinlich, weil diese entweder selbst Nuklearwaffen besitzen und auch im Zweitschlag vergeltungsfähig bleiben (Israel) oder aber unter dem (nuklear-)militärischen Schutzschirm der USA stehen. Auch wenn die nukleare Bewaffnung des Iran dessen regionalen Status erheblich verbessert, ist ein System regionaler Abschreckung – mit der kaum mehr zu verhindernden nuklearen Option Ägyptens, Syriens und der Türkei – möglich und wahrscheinlich. Sichere Konsequenz aber ist die partielle Neutralisierung der konventionellen Schlagkraft Israels – etwa gegen Syrien, wenn der Iran dem syrischen Regime den Nuklearschirm anbietet. Ein weiteres vorrangiges Sicherheitsrisiko ist wiederum die Weitergabe von nuklearem Wissen, Material und Waffen an (nicht-)staatliche Akteure.
Die anreizgeleitete Verzichtsgarantie ist die naheliegendste Handlungsoption: Die Einbindung des Iran in einen – von der EU und den USA abgelehnten – vorbedingungslosen multilateralen Verhandlungsprozess mit einem Mix aus intelligenten Sanktionen, massiven ökonomischen, technischen und politischen Anreizen und der Bereitschaft, das Atomprojekt auch als Prestigevorhaben der iranischen Eliten anzuerkennen, ist der risikoärmste Zugang. Keineswegs sicher ist, dass der Iran damit zu einem völligen Verzicht auf einen eigenständigen Brennstoffkreislauf bewegt werden kann, wohl aber zur Zustimmung zu einem dichten Netz an Überwachungsmöglichkeiten und zu gegenseitiger Vertrauensbildung. Der Iran könnte unterhalb der nuklearen Waffenschwelle gehalten werden und sich mit einer ausbaubaren nuklearen Waffenoption begnügen. Die Einbindung des Iran bietet zugleich die besten Aussichten auf einen langsamen inneren Regimewechsel, wenn durch den Wegfall des äußeren Druckes die nationalistischen Geschlossenheitsbezeugungen ab- und die Artikulation sozialer Unzufriedenheit zunehmen werden.
Die umfassende Anreizstrategie der EU-3, die auch von den USA unterstützt wird, konnte die iranische Führung bislang nicht dazu bewegen, die Vorbedingung für den Eintritt in die Verhandlungen über das EU-3-Paket – die Aussetzung der Urananreicherung und der Wiederaufbereitung – zu erfüllen. Die Resolutionen 1737 und 1747 konnten die iranische Führung bislang ebenfalls nicht zum Einlenken bewegen. Auch die harten Finanzsanktionen durch die USA haben bislang zu keiner erkennbaren Haltungsänderung beigetragen. Allerdings bestehen Hinweise auf wachsende Meinungsdifferenzen innerhalb der iranischen Führungseliten, wenn auch deren Vehemenz aufgrund der intransparenten Führungsstrukturen nur schwer einzuschätzen ist.
Grundsätzlich aber ist der Iran durch ein Sanktionsregime verletzlicher als Nordkorea. Die iranische Wirtschaft ist auf offene Außenhandelsmärkte angewiesen, vor allem aber auf finanzielle Direktinvestitionen und Technologietransfer – insbesondere in der Erdöl- und Erdgasförderung. Daher ist der mittelfristige Erfolg von Sanktionsregimen nicht unwahrscheinlich.
Die militärische Entwaffnung, also die zielgerichtete bewaffnete Zerstörung iranischer Nuklearanlagen, ist eine risikobehaftete, nur beschränkt wirksame und auf keinen Fall eine zwingende Option. Angreifer kennen vermutlich nicht alle Standorte des nuklearen Brennstoffkreislaufs, und die Anlagen dürften stark verbunkert sein. Zudem ist eine militärische Intervention jedenfalls nicht in der Lage, nukleares Wissen und die Beherrschung der Anreicherungstechnologie zu zerstören. Die militärischen Eskalationsrisiken hingegen sind sehr hoch, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Unterbrechung der Öllieferungen durch die Straße von Hormuz sowie die terrorismus-induzierenden Schockwellen wären vermutlich beträchtlich.
Der militärische Regimewechsel bedarf einer massiven Bodenoperation, wofür derzeit sowohl ausreichender politischer Wille als auch militärische Schlagkraft fehlen. Wichtiger noch, intervenierende Streitkräfte würden vermutlich heftigen Widerstand in der iranischen Bevölkerung bewältigen müssen, wodurch auch eine längerfristige Stabilisierung nahezu unmöglich wäre.
Die nüchterne Analyse ist damit klar: Die nukleare Bewaffnung des Iran steht noch lange nicht bevor, die unmittelbare Bedrohung durch einen nuklear bewaffneten Iran ist vermutlich nur in der horizontalen Proliferation und der Auswirkung auf das NPT-System, aber nicht in einem nuklearen Erstschlag etwa gegen Israel gegeben. Militärische Entwaffnungs- und Enthauptungsschläge sind mit immensem Risiko behaftet. Strategisches Kalkül sollte damit die Einbindung des iranischen Regimes in einen Dialog- und Verhandlungsprozess sein, der Sicherheitsrisiken minimiert, Vertrauensbildung ermöglicht, den Iran in ein regionales Sicherheitskonzept einbettet und den evolutionären Regimewandel erleichtert. Scheitert dieser Ansatz, bleibt die Pflicht zur Beseitigung des Regimes. Die Verantwortung zur Untersagung darf nicht aufgegeben werden. Letztlich bleibt – wie im Falle Nordkoreas – nur der längerfristige, evolutionäre Regimewechsel als zwingende und zielführende Option im Umgang mit der Islamischen Republik Iran, sofern diese auf eine nukleare Waffenoption setzen sollte.
Prof. Dr. GERHARD MANGOTT, geb. 1966, ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck.
MARTIN SENN, geb. 1978, Diplompolitologe, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck.
Internationale Politik 5, Mai 2007, S. 89 - 97.